A&W: Ist Armut eine Menschenrechtsverletzung?
Olivier de Schutter: Armut stellt vielfach ein Hindernis für die Erfüllung von Menschenrechten dar. Die meisten Leute sehen Armut nur unter dem Aspekt der geringen Einkünfte. Ich bemühe mich, auf die Diskriminierungen der Menschen zu schauen, wenn ihnen Chancengleichheit verwehrt wird. Armut ist ein Ausdruck von sozialer Exklusion und Erniedrigung. Nicht-materielle Fragen sind auch Elemente von Menschenrechten.
In Ihrem letzten Bericht an die UNO sind sie auf diejenigen eingegangen, die trotz Arbeit in Armut leben, die „Working Poor“. Gibt es diese nur im Globalen Süden oder auch im Norden?
Das ist ein globales Phänomen. Heutzutage ist ein Vollzeitjob keine Garantie mehr, der Armut zu entgehen. In den Ländern mit geringen oder mittleren Einkommen zählt etwa die Hälfte der Erwerbstätigen zu den Armen, in der EU ungefähr 10 Prozent – mit steigender Tendenz. Die Globalisierung hat die Verletzlichkeit der Arbeiter:innen im Süden mit der geschwächten Verhandlungsmacht der Arbeiter:innen im Norden verbunden. Ich war im Mai 2023 in Bangladesch, wo die Unternehmer die Mindestlöhne nicht anheben wollen, da sie damit angeblich an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Zur gleichen Zeit werden die Beschäftigten im Norden unter Druck gesetzt, keine hohen Lohnforderungen zu stellen, ihre Arbeitsplätze würden sonst in Länder verlagert, wo Löhne gering und Gewerkschaften schwach sind. Viele multinationale Unternehmen können so gute Geschäfte machen.
Traditionell wollen Gewerkschaften bessere Löhne und Arbeitsbedingungen erzielen. Warum wird das immer schwieriger?
Ein Teil meines Berichts an die UN-Vollversammlung von 2023 ist den vielfältigen Beschränkungen gewidmet, denen Gewerkschaften heutzutage unterworfen sind. Wir sehen die Aufteilung der Beschäftigten in verschiedene Anstellungskategorien. Manche sind direkt angestellt, andere in Subunternehmen, manche permanent, andere nur zeitweise. Dazu kommt die Prekarisierung und die Automatisierung der Produktion. All das macht die Arbeit für Gewerkschaften schwieriger und hat den Organisationsgrad sinken lassen. Das sind aber auch Gründe, warum eine relevante Zahl der Arbeiter:innen in Armut lebt. Hinzu kommt, dass in vielen Staaten die Mindestlohngesetzgebung zu niedrig angesetzt ist. Und manche Gruppen sind davon sogar ausgeschlossen – wie Landarbeiterinnen und Landarbeiter. Insgesamt ist eine Mehrheit der Menschen im Globalen Süden nicht formal beschäftigt, in Afrika mehr als 80 Prozent. Und zu viele Arbeitsinspektor:innen meinen, informell Beschäftigte würden nicht der Arbeitsgesetzgebung unterliegen. Das ist natürlich falsch!
Viele Regierungen sehen
die Schwächung von Gewerkschaften als einen Vorteil
im Wettbewerb um
Investitionen und Wachstum.
Olivier de Schutter,
UN-Sonderberichterstatter
Starke Gewerkschaften könnten also ein Element im Kampf gegen Armut sein?
Ja, das ist ein Schlüsselthema. Leider stehen die gesetzlichen Regelungen gegen Diskriminierung von Gewerkschafter:innen, Schutz bei Streiks oder Förderung von Tarifverhandlungen oft unter Druck. Viele Regierungen sehen die Schwächung von Gewerkschaften als einen Vorteil im Wettbewerb um Investitionen und Wachstum. Dabei wird oft übersehen, dass es auch schnell zu einem Wettbewerbsnachteil werden kann, wenn Fälle von Gewerkschaftsunterdrückung durch NGOs und Medien publik werden. Viele Regierungen im Süden stecken aber in einer Falle; sie schauen nur auf Kostenvorteile in globalen Lieferketten.
Sie sehen es kritisch, nur das Bruttosozialprodukt als Wohlstandsindikator zu sehen. Aber was sind die Alternativen?
Numerisches Wachstum allein ist nicht die Voraussetzung für soziale Gerechtigkeit und einen notwendigen ökologischen Umbau. Natürlich sollten wir Länder mit niedrigem Einkommen nicht am Wachstum hindern, aber Wachstum darf nicht auf Basis von weniger Arbeitnehmer:innenrechte, umweltschädlicher Produktion oder geringeren Steuern für Unternehmen erwirtschaftet werden. Wir sollten stattdessen bessere Lebensbedingungen, soziale Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit fördern. Diese Aspekte sind nicht weniger wichtig, als das Bruttosozialprodukt zu steigern, und sie stärken demokratische Strukturen in der Gesellschaft.
Sie beschreiben in Ihrem Bericht die Macht großer multinationaler Unternehmen als ein Problem für sozial und ökologisch nachhaltige Entwicklung. Warum?
Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Für die börsennotierten Unternehmen zählt nur, dass die Gewinne ihrer Aktionäre steigen, obwohl unbegrenztes Wachstum in den natürlichen Grenzen des Planeten nicht möglich ist. Es sind die großen Unternehmen, die immer neue Nachfrage schaffen, nicht der Markt, und so wird Wachstum angetrieben – selbst bei wenig sinnvollen Produkten. Außerdem haben große Unternehmen eine enorme Verhandlungsmacht gegenüber den Regierungen. Wenn ihnen Gesetze nicht gefallen, sie höhere Steuern zahlen sollen oder keine Subventionen erhalten, drohen sie sehr schnell mit der Verlagerung von Produktion und Arbeitsplätzen in billigere Länder. So wird ihre ökonomische Macht faktisch zur politischen Macht.
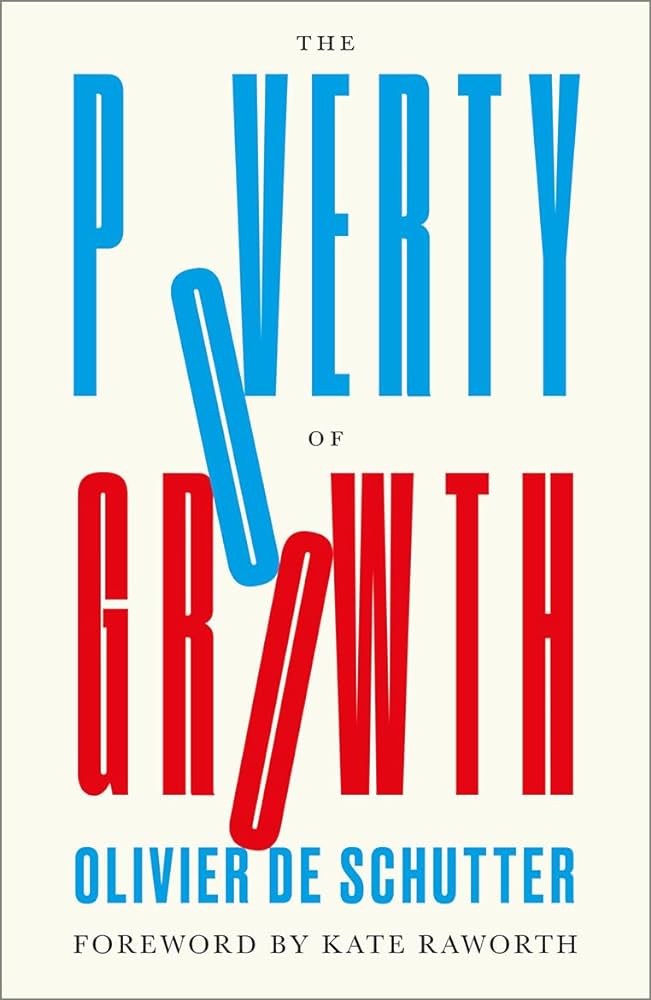
Aber wie kann eine Kontrolle der großen Unternehmen aussehen?
Wirtschaft muss demokratisiert werden. Wir fordern weltweit Demokratie, und das ist gut so. Aber das sollte auch für die Wirtschaft gelten. Die meisten Entscheidungen auf dieser Welt werden von Unternehmen getroffen, die nur ihren Aktionären, aber nicht den normalen Menschen rechenschaftspflichtig sind. Das Konzept der Mitbestimmung sollte ausgedehnt und gestärkt werden, sodass die Beschäftigten ein Veto-Recht bei strategischen Entscheidungen von Unternehmen haben. Dann könnten sie nicht nur gerechtere Löhne einfordern, sondern auch über Dienstleistungen und Produkte der Unternehmen mitreden, die Auswirkungen auf die gesamte Gesellschaft haben.
Weiterführende Artikel:
Die Vermessenheit des Wohlstands
Gegen negative Trends: So kann Wohlstand gesichert werden
Einfluss reicher Menschen auf die Politik: Wer zahlt, schafft an!




