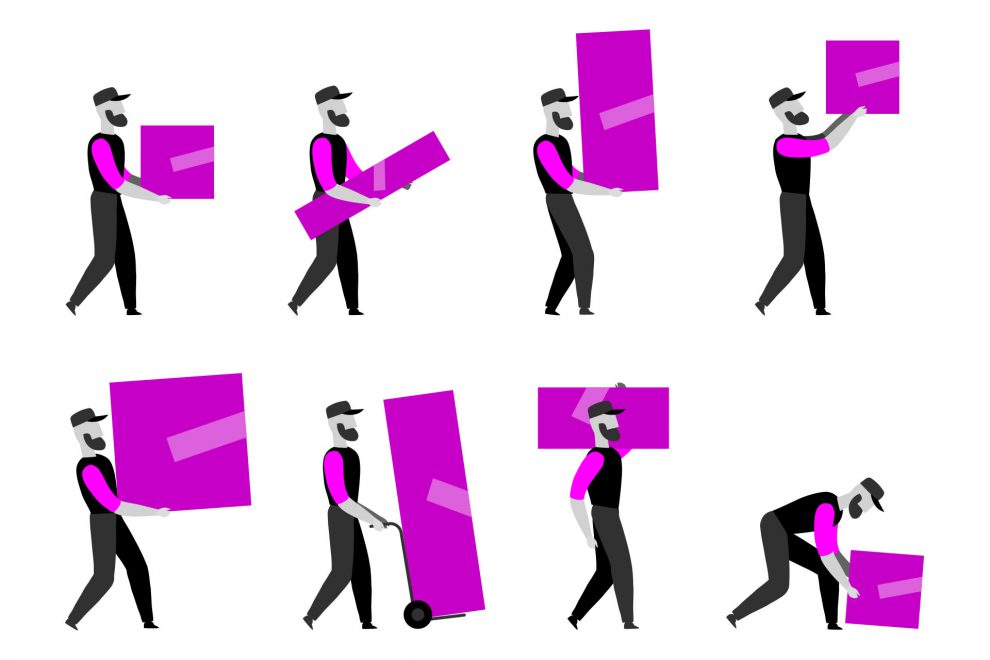Die neue ArbeiterInnenklasse
Menschen in prekären Verhältnissen
von Veronika Bohrn Mena
Er ist Subunternehmer im freien Kleintransportgewerbe, für das es keine Gewerbeberechtigung braucht. Er übernimmt Aufträge eines Frächters, der wiederum Aufträge für die Post übernimmt – so erwirtschaftet er 45 Cent Umsatz pro Paket, das er zustellt. Er hasst seinen Job, er leidet darunter, und er will ihn nur noch hinschmeißen. Er wollte sich bei mir alles von der Seele reden, weil es ihm reicht. Minutiös hat er mir in seiner Wut den Alltag geschildert, der in den letzten drei Jahren sein Leben als Paketbote bestimmt hat.
3.30 Uhr morgens
An sechs Tagen pro Woche, von Montag bis Samstag, läutet sein Handywecker um 3.30 Uhr morgens, um vier Uhr bricht er zur Arbeit auf. Sein Arbeitsweg von Baden bis nach Gerasdorf dauert eine Stunde. Dienstbeginn am Förderband ist um fünf Uhr morgens, in einer schäbigen, dreckigen, stinkenden und unbeheizten Lagerhalle. Im Winter frieren einem dort die Finger ein, im Sommer ist es brennheiß und stickig. Dort folgen eineinhalb bis zwei Stunden, in denen die Pakete mit den richtigen Nummern vom Förderband gehoben und sortiert werden müssen. Wie am Flughafen fahren die Pakete an einem vorbei, bis eines dabei ist, das zur eigenen Lieferroute gehört. Wenn die Pakete falsch liegen, müssen sie gedreht werden, damit man sie aussortieren kann. Das hört sich zwar vielleicht recht unproblematisch an, aber nicht, wenn man bedenkt, dass die Pakete bis zu 35 Kilo wiegen.
Ohne Kreuzschmerzen kann man diese Arbeit nicht machen, und man braucht viel Kraft. Deswegen arbeiten unter den circa 30 Kollegen dort auch nur zwei Frauen, die haben es noch viel härter.
Ercan sagt dazu trocken: „Ohne Kreuzschmerzen kann man diese Arbeit nicht machen und man braucht viel Kraft. Deswegen arbeiten unter den circa 30 Kollegen dort auch nur zwei Frauen, die haben es noch viel härter.“ Danach muss er im Freien, bei jedem Wind und Wetter, seinen kleinen Transporter mit den Paketen für die ihm zugewiesenen Bezirke beladen. Für die Rodel, die er dabei verwendet, ist er ebenso selbst verantwortlich wie für den Transporter, den er fährt. Erst wenn er auf der Straße ist, kann er dann endlich damit beginnen Geld zu verdienen, denn er wird ja nicht nach seiner Arbeitszeit bezahlt, sondern nach der Summe der Pakete, die er zustellt. Er würde mir die Lagerhalle gerne zeigen, damit ich mir ein Bild von den furchtbaren Zuständen dort machen kann. In den kommenden Tagen wird er mir zumindest ein Video davon schicken. Was ich zu sehen bekomme, erschreckt mich, der Boden ist mit Schmutz und Glasscherben von den teilweise gesprungenen Fensterscheiben überseht, die Beleuchtung spärlich, Sitzgelegenheiten oder Waschbecken mit fließendem Wasser sind nicht vorhanden. Nicht einmal Toiletten für die Notdurft gibt es. Das erklärt wohl den Gestank in der Halle, von dem mir Ercan berichtet.
150 Pakete pro Schicht
Zwischen sieben und acht Uhr fährt er die ersten seiner 30 bis 80 Straßen und Gassen in Niederösterreich ab. Er hat wie die meisten Paketboten inzwischen eine Stammtour, die er in- und auswendig kennt. Zwischendurch müssen aber auch immer wieder unliebsame Einsätze als SpringerIn übernommen werden, wenn FahrerInnen ausfallen. Eine Stammtour zu haben ist von hoher Wichtigkeit für die PaketbotInnen, denn wer seine Route und die dazugehörigen Adressen bereits kennt, ist um durchschnittlich 16 Uhr damit fertig. Neue FahrerInnen oder FahrerInnen, die eine neue Route bekommen haben, sind dagegen oft bis 20 Uhr abends unterwegs. Weil nicht alle Türnummern und Namen auch sichtbar angeschrieben sind, eine Einbahn dazwischenkommt, mit der man nicht gerechnet hat, oder man eine kleine Gasse nicht gleich findet.
Ercan war erst 21 Jahre alt, als er als Paketbote zu arbeiten begonnen hat, und konnte es in den ersten Monaten noch ganz gut wegstecken, wenn er bis 20 Uhr abends gebraucht hatte, bis er alle seine 150 Pakete pro Schicht zugestellt hatte. Nach einem halben Jahr kannte er die Straßen, Hausnummern und Parkplätze so gut, dass er inzwischen statt 16 nur noch 12 Stunden dafür benötigt und ohne Pausen hin und wieder schon gegen 16 Uhr damit fertig ist. Er hat aber zunehmend Probleme mit den langen Arbeitszeiten. Nach zwölf Stunden ist er bereits komplett erledigt und will sich nur noch zu Hause hinlegen, jede weitere Stunde schmerzt ihn, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Rücken, die Hände, die Beine, nahezu jede Faser seines Körpers beginnt sich nach so einem Tag bemerkbar zu machen. Nachdem alle Pakete zugestellt wurden, muss er aber noch zur Postfiliale, um die Pakete abzugeben, die nicht zustellbar waren, weil niemand da war. Und um abzurechnen, was er kassiert hat. Es wird darauf bestanden, dass die PaketbotInnen auch diesen Arbeitsschritt noch am gleichen Tag leisten. Selbst wenn das ihre ohnehin schon skandalös lange Arbeitszeit wiederum um weitere rund 30 Minuten verlängert.
Pönalen: 50 Euro
Gefürchtet bei der täglichen Abrechnung sind auch die drohenden Pönalen. PaketbotInnen, die ihre Uniform bei der Arbeit nicht getragen haben, werden sanktioniert, indem ihnen zehn Euro Strafzahlung vom Tageshonorar abgezogen werden. Für EMS-Pakete, die nicht vor zwölf Uhr mittags zugestellt werden konnten, werden ihnen 50 Euro abgezogen, und für Pakete, die zweimal zugestellt werden müssen, gibt es ebenfalls Strafzahlungen. Auch wer seine Fuhre nicht zur Gänze zugestellt hat, bekommt ein Problem. Für jedes einzelne Paket, das nicht zugestellt oder übersehen wurde, werden nämlich weitere zehn Euro vom Honorar abgezogen.
Wer seinen Job nicht verlieren will, der muss es schaffen, mindestens 150 Pakete pro Tag zuzustellen.
„Wer seinen Job nicht verlieren will, der muss es schaffen, mindestens 150 Pakete pro Tag zuzustellen“, erklärt Ercan weiter. Für diese 150 Pakete bekommt man an einem Arbeitstag rund 75 Euro – aber eben nur theoretisch, denn durch Strafzahlungen kann man unverhofft um einen halben Tageslohn umfallen. Bei einem Stücklohn von nur 45 Cent pro Paket braucht es zwar lange, um 50 Euro zu verdienen, aber es geht ganz schnell, sie wieder zu verlieren. Zu den mickrigen 75 Euro Tageshonorar kommen, wenn Ercan Glück hat, noch weitere drei bis vier Euro Trinkgeld hinzu. Deswegen geht er an einem starken Tag von Dienstag bis Freitag mit rund 80 Euro nach Hause. An Montagen und Samstagen werden allerdings weniger Pakete verteilt, „da ist man dann zwar genauso lange unterwegs, weil man die gleiche Tour fährt, aber man verdient nur halb so viel“, begründet er seinen besonderen Frust über die Samstagsdienste.
65-Stunden-Woche
Für ihn ist es unverständlich, warum sie alle sechs Tage die Woche schuften müssen, wo am Wochenende doch ohnehin nur so wenige Pakete aufgegeben werden und sie mit fünf Arbeitstagen schon unter einer 65-Stunden-Woche leiden. Aber da er und der Großteil seiner KollegInnen als Selbstständige gelten, gilt für sie auch kein Arbeitszeitgesetz oder Kollektivvertrag und somit keine Höchstarbeitszeit. Die Konsequenz daraus ist für sie nicht selten, dass sie schuften müssen bis zum Umfallen, weswegen ihre wöchentliche Arbeitszeit mit 48,6 Stunden im Mittel um mehr als zehn Stunden höher ist, als die von unselbstständig Beschäftigten. [2]
700 Euro zum Überleben
Nach seinen harten Arbeitstagen kann er sich kaum mehr auf den Beinen halten. Er versucht so rasch wie möglich nach Hause zu kommen, bei dem abendlichen Verkehr auf der Tangente benötigt er für die Heimfahrt weitere eineinhalb Stunden. Zu Hause angekommen, legt er sich sofort hin und schläft, bis nur acht Stunden später sein Handywecker wieder läutet, er zur nächsten Schicht muss und alles wieder von vorne beginnt. „Man muss jung und fit sein, sonst schafft man das nicht“, erzählt er und erklärt damit auch gleichzeitig, warum er den Job einfach nicht mehr ausgehalten hat. „Für einen Hungerlohn von knapp 400 Euro brutto wöchentlich arbeitet man sich total kaputt. Ich bin 25 Jahre alt und habe Rückenprobleme wie ein alter Mann. Wenn ich am Sonntag frei habe, kann ich nicht ausschlafen, weil mein Körper sich schon auf die frühmorgendliche Arbeit eingestellt hat. Ich bin immer müde und habe in den letzten drei Jahren fast alle meine Freunde verloren, weil ich keine Zeit und keine Kraft mehr habe, um sie zu treffen. Eine Frau kann ich so auch nicht kennenlernen. Eigentlich habe ich gar kein Leben mehr, sondern arbeite nur“, beschreibt Ercan verzweifelt seine Lage.
Für einen Hungerlohn von knapp 400 Euro brutto wöchentlich arbeitet man sich total kaputt. Ich bin 25 Jahre alt und habe Rückenprobleme wie ein alter Mann. Wenn ich am Sonntag frei habe, kann ich nicht ausschlafen, weil mein Körper sich schon auf die frühmorgendliche Arbeit eingestellt hat. Ich bin immer müde und habe in den letzten drei Jahren fast alle meine Freunde verloren, weil ich keine Zeit und keine Kraft mehr habe, um sie zu treffen.
Sein Einkommen muss er als „Neuer Selbstständiger“ selbst versteuern und sich bei der SVA selbst versichern. Danach bleiben ihm rund 700 Euro monatlich übrig, um zu überleben. Die Einkommensstruktur der Ein-Personen-Unternehmen ist sehr breit, und es gibt natürlich auch solche, die für ihre mitunter riskante Arbeit hohe Umsätze erzielen. Insgesamt sind ihre Einkommen jedoch im Vergleich zu ähnlich qualifizierten unselbstständig Erwerbstätigen niedrig. Ihr Median-Einkommen liegt bei rund 16.300 Euro jährlich, das von unselbstständig Erwerbstätigen bei knapp 20.000 Euro. Deswegen gelten fast 14 Prozent der Soloselbstständigen auch als armutsgefährdet, fast doppelt so viele wie bei den restlichen Erwerbstätigen. Rund 87.000 Ein-Personen-Unternehmen erzielen sogar so geringe Einkommen, dass sie damit nicht einmal die Steuergrenze von 11.000 Euro jährlich erreichen. Eine so hohe Zahl von Einkommen unter der Steuergrenze bedeutet, dass der ohnehin schon sehr niedrige Gesamtschnitt der EPU-Einkommen in Wirklichkeit noch tiefer liegt. Umgekehrt ist die vergleichsweise hohe Armutsgefährdung unter den Soloselbstständigen dadurch wohl noch höher. [3]
Miete für Arbeitsgeräte
Und dann sind da noch die Kosten, die die PaketbotInnen selbst tragen müssen, um ihre Arbeit überhaupt ausüben zu können. Allein die Postjacke, die Ercan tragen muss, muss er von seinem eigenen Geld bezahlen, und die kostet schon 70 Euro, die Polo-Shirts kosten weitere 10 Euro. Für das Gerät, auf dem die EmpfängerInnen der Pakete die Zustellung bestätigen müssen, muss er monatlich noch 80 Euro Miete bezahlen. Und schließlich der größte Brocken, der Treibstoff und die Leasinggebühren für den Transporter, auch dafür und für dessen Erhalt muss er aufkommen.
Denn die Subunternehmen, die die Pakete für den Frächter der Post zustellen, stehen unter doppeltem finanziellem Druck und tragen ein hohes unternehmerisches Risiko. Sie sind entweder Ein-Personen-Unternehmen oder kleine Unternehmen mit circa fünf Beschäftigten und sind verpflichtet, sowohl die Vorschriften der Post als auch die des Frächters einzuhalten. Dafür sind sie nicht nur allein verantwortlich, sie müssen auch die volle Haftung dafür tragen. 10.320 Ein-Personen-Unternehmen arbeiten in der Sparte Transport und Verkehr, wie viele KleintransportunternehmerInnen wie Ercan es gibt, kann nur geschätzt werden. [4]
EPU – eine bunte Mischung
Generell ist die Datenlage über die „Neuen Selbstständigen“ in Österreich eher schlecht. Obwohl sie sich von Ein-Personen-Unternehmen und klassischen UnternehmerInnen schon auf den ersten Blick durchaus stark unterscheiden. Die Verteilung ihres formalen Ausbildungsniveaus stellt sich different dar: Rund ein Drittel von ihnen hat nur einen Pflichtschul- beziehungsweise Lehrabschluss. Bei den Vollzeitbeschäftigten ist über die Hälfte im Pflichtschul- bzw. Lehrbereich zu verorten, bei Teilzeitbeschäftigten beläuft sich dieser Anteil aber nur auf 30 Prozent. Es sind vor allem männliche Solo-Selbstständige, die mit einem Anteil von 19,5 Prozent gehäuft allein leben oder allerdings wiederum mit fünf und mehr Personen gemeinsam im Haushalt wohnen. Das liegt daran, dass die Gruppe der Ein-Personen-Unternehmen und Neuen Selbstständigen so heterogen ist wie kaum eine andere.
EPU – Zahlen, Daten, Fakten
- Nach dem Alter ergeben sich deutliche Unterschiede in den Ausbildungsniveaus von Solo-Selbstständigen: So sind ältere ab 65 Jahren häufiger in höheren Ausbildungssegmenten zu verorten und seltener im Pflichtschul- bzw. Lehrbereich sowie unter Fach- bzw. HandelsschulabsolventInnen zu finden.
- 83 Prozent sind älter als 35 Jahre.
- Der Frauenanteil unter Solo-Selbstständigen liegt bei 41,7 Prozent, während er bei unselbstständigen Erwerbstätigen bei 45,3 Prozent liegt. Ihr durchschnittliches Alter liegt bei 45 Jahren, das von unselbstständigen Erwerbstätigen bei 39 Jahren.
- Männer verdienen im Schnitt zwischen 28 Prozent (Median-Einkommen) und 38 Prozent (arithmetisches Mittel des Einkommens) mehr als Frauen. Starke Unterschiede zeigt auch die berufliche Stellung. Die freiberuflich Tätigen weisen einen mehr als doppelt so hohen Einkommensmedian auf (39.451 Euro) als die beste nachfolgende Gruppe (Neue Selbstständige 16.621 Euro).
- 7,0 Prozent aller Solo-Selbstständigen üben eine unselbstständige Zusatzbeschäftigung aus, das entspricht 20.085 Personen. Ob bei diesen die selbstständige oder die unselbstständige Tätigkeit die Haupteinkunftsquelle darstellt, ist nicht bekannt.
- In den letzten zehn Jahren wurden im Schnitt 15.000 EPU-Neugründungen pro Jahr verzeichnet.
Vom Fotografen, der Architektin, dem Finanzbuchhalter, der Masseurin, dem Regalbetreuer im Supermarkt, der Büroservicekraft bis zur 24-Stunden-Pflegerin sind alle vertreten. Die Fachgruppen, die den höchsten Anteil an ihnen stellen, sind laut Wirtschaftskammer die „Personenberatung und Personenbetreuung“, in dieser sind 98,4 Prozent EPU, im „Direktvertrieb“ 93 Prozent und bei sogenannten „Persönlichen Dienstleistern“ immer noch 85,5 Prozent. Die mit Abstand größte aller Fachgruppen, mit mehr als doppelt so vielen Mitgliedern wie alle anderen, ist die der Personenberatung und Personenbetreuung mit fast 70.000 Ein-Personen-Unternehmen.[5] Fast ein Viertel aller EPU dürften demnach also 24-Stunden-Pflegerinnen sein, die mit echten selbstständigen UnternehmerInnen eigentlich nichts zu tun haben. Sie können weder frei über ihre Zeit verfügen, sich vertreten lassen noch ihren Arbeitsalltag nach ihren eigenen Wünschen gestalten, sondern sind zu 100 Prozent weisungsgebunden und von nur einem Arbeitgeber vollkommen abhängig. Und so wie die Pflegerinnen leiden auch viele andere EPU unter allen Nachteilen der Selbstständigkeit, wie unternehmerischen Risiken und schwacher sozialer Absicherung, kommen aber nicht in den Genuss der Vorzüge, wie Freiheit und Flexibilität.
Keinerlei Absicherung
Für Ercan wäre es unter diesen Voraussetzungen mit diesem Hungerlohn gar nicht möglich, sich allein zu erhalten und zu überleben. Er hatte zwar vor einem Jahr eine eigene Wohnung gesucht, aber da er keine fixe Anstellung und kein sicheres Einkommen vorweisen kann, wollte ihm kein Vermieter einen Mietvertrag ausstellen. Auch an der Kaution für eine Wohnung wäre er gescheitert, er hat keine Ersparnisse und keinen Überziehungsrahmen bei der Bank. An einen Kredit brauche er als Ein-Personen-Unternehmen ohne Sicherheiten gar nicht zu denken, wurde ihm sehr direkt entgegengeworfen, als er bei mehreren Banken um einen solchen gebeten hatte. Inzwischen ist er froh darüber, dass er keine Wohnung gefunden hat und weiterhin bei seinen Eltern wohnhaft bleiben musste. Ansonsten wäre er jetzt wohl auch noch verschuldet. So ist er, nach drei Jahren in diesem Job, zumindest nur pleite.
Ich würde alles machen, jede Arbeit ist mir recht. Es geht nicht darum, dass ich etwas Bestimmtes arbeiten möchte, ich will nur wieder mehr Sicherheit haben. Ich will keine Angst mehr davor haben müssen, krank zu werden, und plötzlich wieder ohne Geld dastehen.
Einmal hätte er sogar beinahe seinen Handyvertrag verloren. Weil er bei der Arbeit, beim Heben eines schweren Pakets, umgeknickt war und sich am Knie verletzt hatte, konnte er zweieinhalb Wochen nicht arbeiten, verlor dadurch über die Hälfte seines Monatseinkommens und hatte ein ungedecktes Konto. Die Erinnerung daran, wie er bei seinem Mobilfunkanbieter um Ratenzahlungen betteln musste, ist ihm noch heute extrem unangenehm. Wenn er gekonnt hätte, hätte er schon vor Langem alles hingeworfen und mit dieser schrecklichen Arbeit aufgehört, sagt er, aber er hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und wollte nicht um Mindestsicherung ansuchen müssen. Und weiter: „Ich würde alles machen, jede Arbeit ist mir recht. Es geht nicht darum, dass ich etwas Bestimmtes arbeiten möchte, ich will nur wieder mehr Sicherheit haben. Ich will keine Angst mehr davor haben müssen, krank zu werden, und plötzlich wieder ohne Geld dastehen. Außerdem bin ich fertig, weil ich seit drei Jahren durcharbeite, abgesehen von der Zeit, als mein Knie kaputt war.“
Der schlimmste Job
Ercan hat mit 17 Jahren seine Schulkarriere in einer Handelsakademie abgebrochen, weil er zuletzt über 600 Fehlstunden hatte und überhaupt nur noch zu Schularbeiten am Unterricht teilgenommen hat. Er erzählt, dass er dringend Geld verdienen wollte, auf nähere Gründe und seine familiäre Situation will er nicht weiter eingehen. Er erklärt, dass es ihm unangenehm ist, darüber zu reden, und dass ich zwar über alles schreiben kann, was er mir über seine Arbeit erzählt, aber nicht über seine Familie. Ich habe ihm natürlich versichert, mich daran zu halten. Mit 18 Jahren hat er begonnen bei McDonalds in der Shopping City Süd an der Kassa und im Verkauf zu arbeiten. Eine Lehre konnte er dort nicht absolvieren, weil ihm die Bezahlung als Lehrling nicht ausgereicht hätte. In der Folge hat er dann zweieinhalb Jahre als Lagerarbeiter in der Zentrale bei Anker, im zehnten Wiener Gemeindebezirk, gearbeitet. Er war in der Kommission, in der Kühlhalle tätig, hat die Bestellungen der einzelnen Filialen sortiert und tiefgefrorenes Brot in Boxen für den Transport verpackt. In dieser Zeit hat er den Anlauf unternommen, die Abendschule zu besuchen, aber nach einem Semester hat er damit wieder aufgehört, weil ihm die Schule nach und neben der Arbeit zu anstrengend war. Dann war er beim Bundesheer, und zwei Monate, nachdem er seinen Wehrdienst abgeschlossen hatte, hat er seinen heutigen Job als Paketbote begonnen.
Paketbote ist der schlimmste Job, den ich je gemacht habe. Bei McDonalds habe ich immerhin 700 Euro für 20 Stunden Dienst pro Woche bekommen, beim Anker sogar fast 1.500 Euro für Vollzeit, weil eine Kältezulage dabei war.
Mit belegter Stimme sagt er leise: „Paketbote ist der schlimmste Job, den ich je gemacht habe. Bei McDonalds habe ich immerhin 700 Euro für 20 Stunden Dienst pro Woche bekommen, beim Anker sogar fast 1.500 Euro für Vollzeit, weil eine Kältezulage dabei war.“ Seit ein paar Wochen bemüht er sich wieder, eine Stelle als Lagerarbeiter zu bekommen, und nach vielen Bewerbungen scheint er erstmals wieder Anlass zur Hoffnung zu haben. Kommende Woche ist er zu einem Probearbeiten eingeladen worden, er scheint sich darauf richtig zu freuen. Er wünscht sich nicht mehr, als ein bescheidenes Leben ohne Angst und Armut führen zu können.