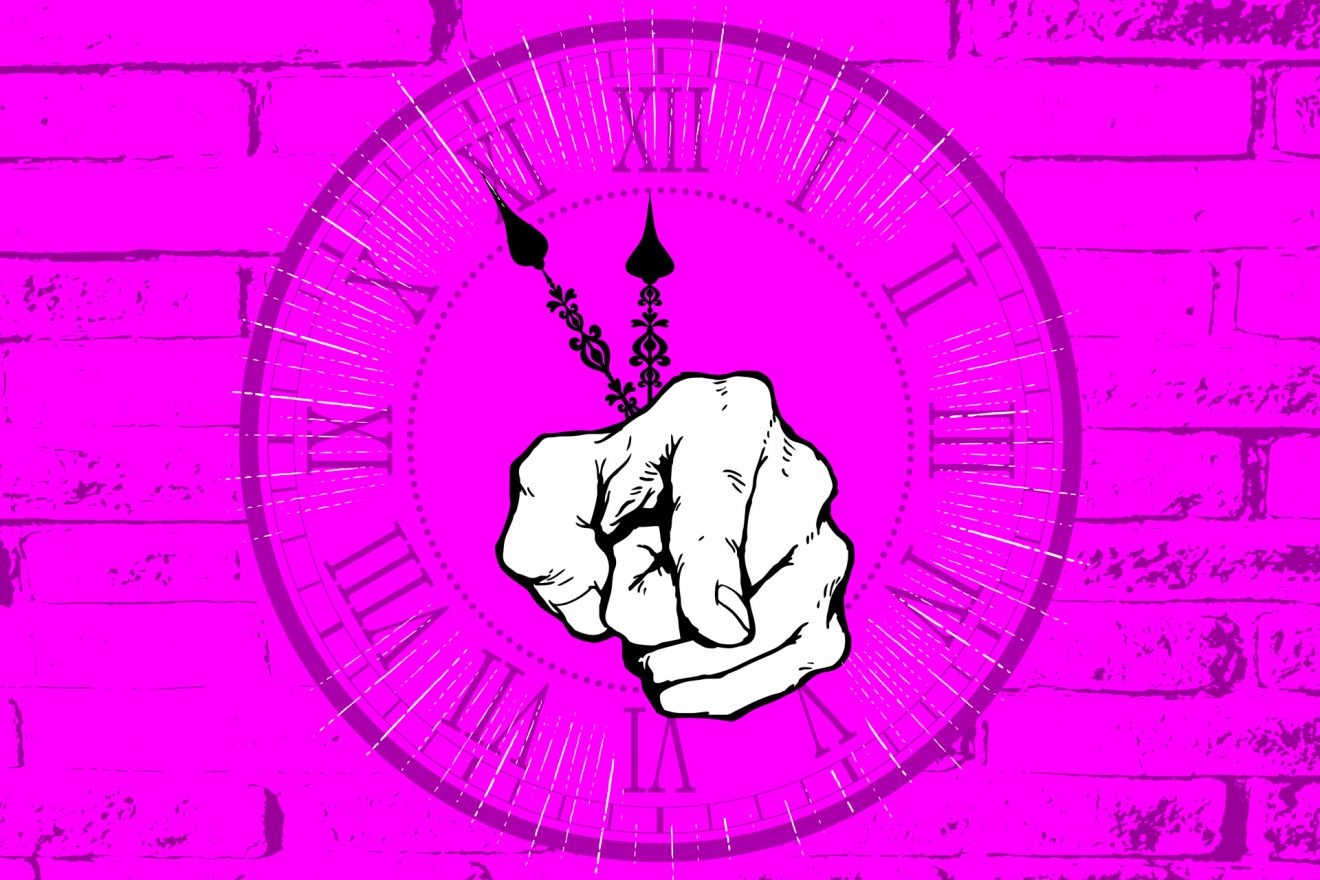ls die Schwarz-blaue Regierung vor etwas über einem Jahr den 12-Stunden-Arbeitstag beschloss, wurde diese Maßnahme nicht nur faktisch, sondern vor allem ideologisch diskutiert. Die Regierung wandte dabei drei rhetorische Techniken an, um den 12-Stunden-Tag zu legitimieren und die Kritik daran als unlauter zu delegitimieren.
Der 12-Stunden-Tag ist alternativlos
„Betont wurde vom Kanzler die Notwendigkeit, sich auch über eine gewisse Flexibilisierung dem globalen Wettbewerb zu stellen. Denn Österreich müsse wettbewerbsfähig bleiben, wenn man den Sozialstaat finanzieren wolle.“
Die Idee, dass neoliberale Einschnitte ohne Alternative sind, ist von Margaret Thatcher geprägt worden. Der freie Markt war für sie der beste und einzige Weg zu Wohlstand und Frieden. Wenn Härten und Ungleichheiten entstehen, dann sind diese anzunehmen, da sie im besten Interesse des großen Ganzen sind. Auf dieses TINA-Prinzip (There is no alternative-Prinzip) verweist auch der damalige Kanzler Sebastian Kurz.
Der Zusatz, dass sonst der Sozialstaat nicht zu erhalten sei, ist zudem eine subtile Art der Angsterzeugung und des Auseinanderdividierens der Lohnabhängigen. Weil so viele Menschen von einem ausladenden Sozialstaat abhängig sind, müssen jene, die mit ihrer Arbeitskraft den Sozialstaat erhalten, sich besonders anstrengen. Anstatt den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit zu sehen, wird das Gegensatzpaar „produktiv“ und „unproduktiv“ geschaffen. Auf der einen Seite die Unternehmer_innen und die Arbeitnehmer_innen, auf der anderen Seite jene, die sich von einem Sozialstaat erhalten lassen.
Anstatt den Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit zu sehen, wird das Gegensatzpaar „produktiv“ und „unproduktiv“ geschaffen. Auf der einen Seite die Unternehmer_innen und die Arbeitnehmer_innen, auf der anderen Seite jene, die sich von einem Sozialstaat erhalten lassen.
Dieser Gegensatz ist insofern bizarr, da ja auch arbeitende Menschen Leistungen aus dem Sozialstaat bekommen, etwa Familienbeihilfe, aber auch Personen, die mehrheitlich von Transferleistungen abhängig sind, zusätzlich arbeiten. Diese Strategie dient dazu, eine vermeintliche Interessengleichheit zwischen Arbeitgeber_innen und Arbeitnehmer_innen im Gegensatz zu den Anderen herzustellen: Die Chef_innen und die Mitarbeiter_innen sitzen im selben Boot und müssen sich gemeinsam anstrengen, dazu gibt es keine Alternative. Hier werden Machtgefälle, unterschiedliche Rechte und Pflichten und nicht zuletzt eine gänzlich unterschiedliche Entlohnung schlicht zu Ungunsten der Arbeitnehmer_innen negiert.
Der 12-Stunden-Tag ist Freiheit
Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) bemühte bei ihrer Verteidigung des Pakets Karl Marx: Dieser habe gesagt, „Freiheit ist ein Luxus, den sich nicht jedermann leisten kann“. Mit der nun vorliegenden Arbeitszeit-Regelung „ist diese Freiheit für jedermann und jederfrau möglich“, hob die Ressortchefin die Möglichkeit zur Konsumation von größeren Freizeit-Blöcken hervor.
Der 12-Stunden-Tag wird mit großen Worten als Akt der Freiheit gepriesen. Das wirkt auf den ersten Blick logisch. Regulationen und Verbote schränken ein und nehmen ja Möglichkeiten vom Spielfeld. Umso mehr Möglichkeiten ich habe, umso größer meine Auswahl ist, umso mehr Freiheit besitze ich. In einer Beziehung unter Gleichen stimmt das auch. Ein sehr banales Beispiel: Wenn es im Restaurant nicht nur Nudelsuppe, sondern auch Frittatensuppe oder Tomatensuppe gibt, dann ist in dem Moment meine individuelle Freiheit größer, da ich nach meinem Gusto entscheiden kann, welche Suppe ich essen möchte. An diesen Gedanken der breiteren, freien Auswahl schließt die Idee an, den 12-Stunden-Tag als Freiheit zu verkaufen. Er ist eine weitere Auswahlmöglichkeit unter vielen.
Negiert wird aber, dass unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen keine Gleichheit der Interessen zwischen Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen besteht, sondern sich die Interessen im Gegenteil diametral gegenüberstehen. Arbeitgeber_innen haben ein Interesse an Produktions- und Gewinnsteigerung zu möglichst geringen Kosten, Arbeitnehmer_innen haben Interesse an sicheren Arbeitsplätzen, Gesundheit, hohen Löhnen und Freizeit. Beides ist aus der jeweiligen Sicht Freiheit. Die Freiheit der Einen läuft aber der Freiheit der Anderen zuwider. Nicht weil die Einen so böse sind und alle einander nix gönnen, sondern weil der Gegensatz systemisch bedingt ist.
Negiert wird aber, dass unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen keine Gleichheit der Interessen zwischen Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen besteht, sondern sich die Interessen im Gegenteil diametral gegenüberstehen.
Die Sozialpartnerschaft bemüht sich im Nachkriegssozialstaat, diesen Gegensatz so auszutarieren, dass beide Seiten halbwegs zufrieden sind. Wenn aber die Freiheit der Unternehmer_innen als Freiheit der Arbeitnehmer_innen verkauft wird, dann ist das der Versuch, Unfreiheit als Freiheit zu maskieren. Denn ein breiteres Angebot an Arbeitsweisen heißt ja, dass die Unternehmer_innen aus diesen wählen können, und nicht die Arbeitnehmer_innen. Für diese steht ja eine Arbeitszeitverkürzung zum Beispiel nicht auf der Menükarte. Freiheit ist aber ein so großer und anziehender Gedanke, dass es sehr leicht ist, sich darüber zu freuen, wenn sie einem versprochen wird. Es sollte nur immer darauf geachtet werden, wem Freiheit versprochen wird und zu wessen Lasten diese geht.

Die Gegner_innen des 12-Stunden-Tags gefährden den sozialen Frieden
Auf die Frage, wie oft eine Billa-Verkäuferin ablehnen kann, bevor sie gekündigt wird, sagte Hartinger-Klein: „Sie wird den Job nicht verlieren. Wenn sie dreimal Nein sagt und der Arbeitgeber kündigt sie, dann wird sie beim Sozialgericht gewinnen“. Dass die Betriebsräte nicht eingebunden werden, begründete die Ministerin damit, dass es oft so sei, dass „der Betriebsrat etwas anderes will als der einzelne Arbeitnehmer“. Die Sozialpartner seien jetzt gefordert, sozialen Unfrieden abzuwenden.
Die Regierung hat das Beste für alle im Sinne, während Gewerkschaften, Arbeiter_innenkammer und Betriebsrät_innen Unruhe stiften und, so der Subtext, gierig sind und nur zum eigenen Vorteil eine gute Sache torpedieren. Das ist einerseits eine Immunisierung gegen Kritik und andererseits eine Delegitimation der institutionalisierten Vertretungen der Arbeitnehmer_innen. Diese wüssten ja gar nicht, so der Vorwurf, was im Interesse der von ihnen Vertretenen sei. Hier wird das Bild einer abgehobenen Elite gezeichnet, die nur auf ihren eigenen Vorteil aus ist, während Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen gemeinsam das Bedürfnis nach einem 12-Stunden-Tag äußern.
Dieser Trick des Reinspaltens dient der rhetorischen wie politischen Schwächung des Gegners. Die Arbeitnehmer_innen sollen verunsichert werden, sich fragen, ob ihre eigene gewählte Vertretung überhaupt ihre Interessen im Blick hat.
Dieser Trick des Reinspaltens dient der rhetorischen wie politischen Schwächung des Gegners. Die Arbeitnehmer_innen sollen verunsichert werden, sich fragen, ob ihre eigene gewählte Vertretung überhaupt ihre Interessen im Blick hat. Im Wahlkampf würde man dazu „negative campaigning“ oder Anpatzen sagen. Der gewünschte Effekt ist ein Vertrauensverlust in demokratisch gewählte Interessenvertretungen, denn ohne diese ist natürlich die Position der Arbeitnehmer_innen an sich geschwächt und Maßnahmen wie der 12-Stunden-Tag leichter durchzubekommen.
Mittlerweile ist der 12-Stunden-Tag vom Freiheitsversprechen zur bitteren Realität in einem Drittel aller Unternehmen geworden.
Mittlerweile ist der 12-Stunden-Tag vom Freiheitsversprechen zur bitteren Realität in einem Drittel aller Unternehmen geworden. Ohne Bezahlung der Überstunden bedeutet das einen Reallohnverlust für diese Arbeitnehmer_innen. Freiheit ist für die Macher_innen des 12-Stunden-Tags also immer nur die eigene Freiheit und nicht die der Anderen.