Das schürt Ängste – teils durchaus berechtigte. Bei Social Media begriff die Politik recht spät, dass hier Regulierungen nötig sind, in Österreich gibt es dazu inzwischen zum Beispiel ein Gesetz gegen Hass im Netz. Was können wir noch von früheren Evolutionsschritten der Medienwelt lernen? Der Blick in die Geschichte befördert jedenfalls spannende Parallelen ans Licht. Hoch gingen die Wogen etwa Mitte des 15. Jahrhunderts, nachdem Johannes Gutenberg in Deutschland den modernen Buchdruck erfunden hatte.
Vor dem Hintergrund, dass man seit Jahrtausenden vor allem mit der Hand geschrieben hatte, habe die Drucktechnik „unter anderem die Befürchtung hervorgerufen, dass Wissensbestände in falsche Hände gelangen“, erzählt der Historiker Tim Neu von der Universität Wien. „Zudem gab es seitens der Kritiker:innen die Sorge, dass auch viel Unnützes oder Lasterhaftes veröffentlicht werden könnte und dass es zu einer Qualitätsverschlechterung des Geschriebenen kommt“, sagt Neu. Und weil Texte viel schneller vervielfältigt werden konnten, bestand nicht zuletzt die Angst, dass viele Schreiber:innen ihre Arbeit verlieren würden.
Die Zeit lässt sich nicht zurück drehen.
Wichtig ist, einen Weg zu finden, kompetent damit umzugehen.
Tim Neu
Dem sollte am Ende nicht so sein, wie Neu betont. Denn die Einführung des Buchdrucks habe im Endeffekt nicht zu einer Verdrängung des handschriftlichen Schreibens, sondern sogar zu einer Steigerung geführt. Die Obrigkeit ließ zum Beispiel Formulare drucken, die ausgefüllt werden mussten – und solche Synergieeffekte sind auch bei heutigen Technologiefortschritten nicht auszuschließen. „Schriftlichkeit hat sich mit dem Buchdruck insgesamt noch stärker durchgesetzt“, betont Neu. Was zeigt: „Die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen“, ein neues Medium lasse sich nicht mehr verbieten. „Wichtig ist, einen Weg zu finden, kompetent damit umzugehen.“
Die Macht der Information
Das sieht auch die Kommunikationswissenschafterin Annie Waldherr von der Universität Wien so. Die größte Medienrevolution nach der Einführung des Buchdrucks sei die Etablierung des Radios als Massenkommunikationsmittel in den 1920er-Jahren gewesen. Davor hatte einerseits die Erfindung der Tageszeitung Anfang des 17. Jahrhunderts für Fortschritt bei der Verbreitung aktueller Nachrichten gesorgt, andererseits konnten Informationen ab Mitte des 19. Jahrhunderts durch Erfindungen wie das Dampfschiff, die Eisenbahn und später den Telegrafen viel größere Reichweiten erzielen.
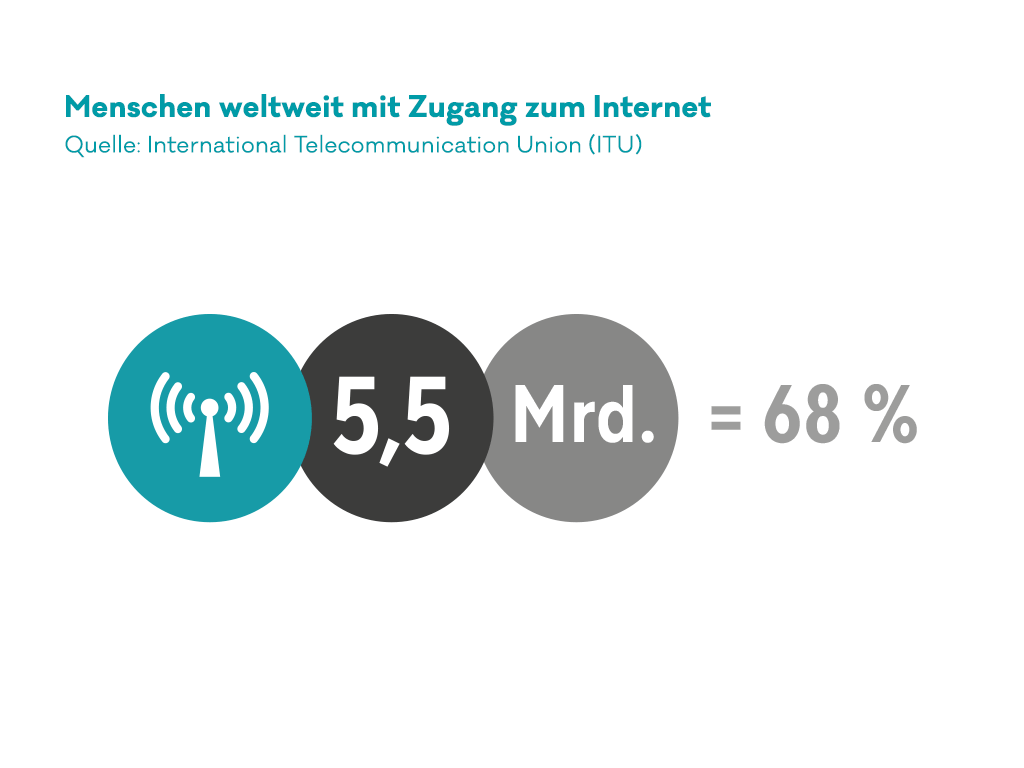
Das Radio sei vom NS-Regime dann stark als Propagandamedium eingesetzt worden, sagt Waldherr. Das führte nach der Zeit des Nationalsozialismus bei der Einführung des Fernsehens zu Warnungen, dass das Fernsehen ein noch viel mächtigeres Medium sei, daher habe man auch größere Anstrengungen unternommen, dieses zu regulieren. In Deutschland und Österreich führte das in den 1950er-Jahren zur Geburt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. „Das Fernsehen sollte weder in die Hände von privaten Unternehmen fallen noch zu einem Staatsfunk werden“, sagt Waldherr.
Immer mehr Firmen setzen auf Chatbots: ÖGB-Digitalisierungsexperte Sebastian Klocker erklärt, wie Künstliche Intelligenz Jobs verändert:
#Chatbots #Digitalisierung
Eine der Befürchtungen, die laut der Forscherin mit der Entwicklung eines jeden neuen Mediums einhergehe, sei jene, dass Menschen sich in einer stark fragmentierten Medienlandschaft so unterschiedlich informieren, dass es kaum mehr eine gemeinsame Realität gebe, was den gesellschaftlichen Zusammenhalt schwäche. „Die Mediennutzung war aber immer schon selektiv: Selbst wenn Menschen dieselbe Zeitung lesen, konsumiert der eine nur den Sportteil, die andere nur die großen Schlagzeilen.“ Die Tendenz, sich seine Inhalte auszusuchen, habe es immer schon gegeben. „Hier zeigt uns auch die Forschung, dass die Befürchtung von Echokammern und Filterblasen eigentlich übertrieben ist. An den gesellschaftlichen Rändern, die sich Mainstream-Medien ganz verweigern, kann es aber durchaus so sein“, sagt Waldherr.

Keine Torwächter
Die sozialen Medien hätten jedenfalls aufgezeigt, dass es keine Gatekeeper-Funktion wie in klassischen Medien mehr gebe, so Waldherr. Das bedeutet, dass keine Journalist:innen mehr die Einordnung und Überprüfung von Nachrichten übernehmen. Da vor allem Jüngere soziale Medien zur Nachrichteninformation nutzen, „ist das schon etwas besorgniserregend“. Waldherr weist aber – ebenso wie Neu – darauf hin, dass es immer zu Wechselwirkungen zwischen bereits etablierten und neuen Medien komme. So könnten journalistische Medien jene Informationen, die auf Social Media kursieren, nun einem Faktencheck unterziehen. Das passiere bisweilen auch schon, ein Mehr wäre aber wünschenswert.
Wie sich KI-Anwendungen wie ChatGPT entwickeln würden, sei noch nicht abzusehen, meint Waldherr. Solche Programme seien aber vom Arbeitsmarkt bald nicht mehr wegzudenken – daher brauche es einen kompetenten Umgang damit. Wie bei der Digitalisierung würden zwar einerseits Jobs verschwinden, aber dafür andere entstehen. Und Anwendungen wie ChatGPT würden sich für viele Arbeitnehmer:innen zu einer Art Co-Worker etablieren. „Es wird jedenfalls niemand darum herumkommen, sich damit auseinanderzusetzen und es als Tool zu nutzen“, so die Kommunikationsforscherin. Anders als bei den Social-Media-Plattformen versuche hier die Politik aber schon früher, zu Regulierungen zu kommen.
Weiterführende Artikel
„Vergessen wir nicht, dass der Mensch nie in totaler Kontrolle seines Lebens ist“
