Das Tagesklinik-Prinzip im Hanusch-Krankenhaus
Vor zehn Jahren hat Professor Felix Keil den Grundstein für den Um- und Ausbau seiner Abteilung gelegt. „Das war auch notwendig“, wie er im Gespräch mit Arbeit&Wirtschaft nach Ende der Visite betont. Denn in den vergangenen 20 Jahren hat sich die Zahl der Patient:innen mit schweren, bösartigen Bluterkrankungen in Wien fast auf 10.000 verdoppelt – insgesamt 150.000 weisen eine Blutbildveränderung auf, zum Beispiel Mangelerhöhung oder Blutkomplikationen – wie das Rheuma des Blutes. Es sind neue Arzneimittel hinzugekommen, die eine orale Einnahme möglich machen, sodass nicht mehr nur Infusionen verabreicht werden müssen. Die neuen Medikamente erhöhen zudem die Lebenserwartung.
„Wir behandeln heute auf unseren Stationen, in der Tagesklinik und den einzelnen Gesundheitszentren 5.000 Patient:innen – doppelt so viele Menschen wie vor zehn Jahren.“ Dafür hat Professor Keil auch das hämatologische Fachpersonal verstärkt. „Wir sind jetzt ein Schwerpunktkrankenhaus für Hämatologie“, sagt er, „und ohne diesen Ausbau vor zehn Jahren hätten wir Corona nie stemmen können.“
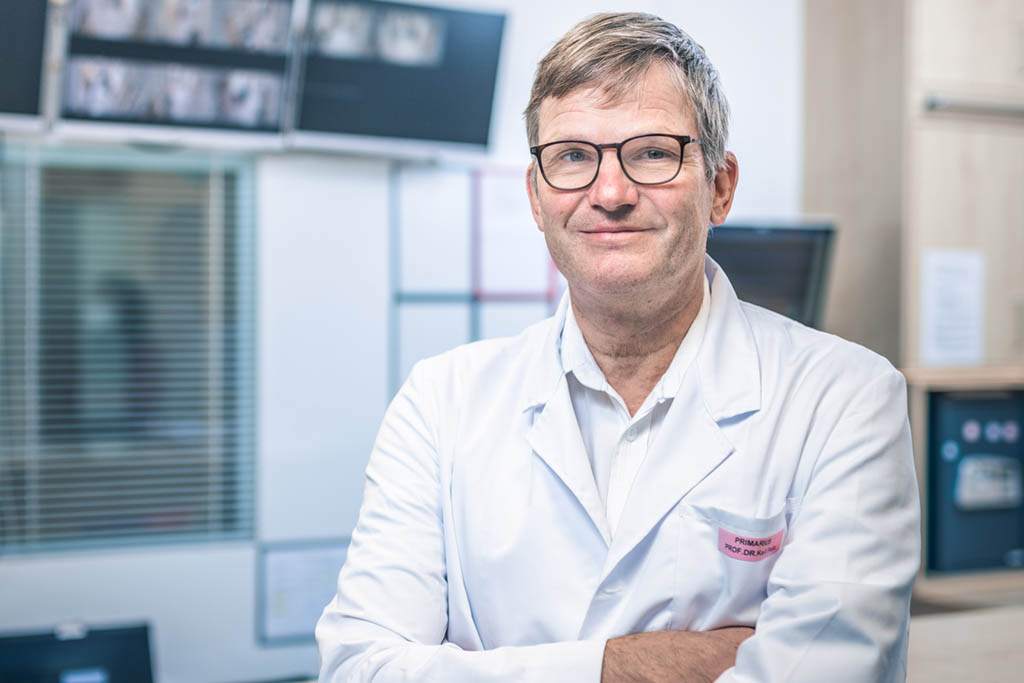
Die Bettenstation wäre aus allen Nähten geplatzt. Daher hat er das neue Modell entwickelt, damit nicht jeder:jede Patient:in bei Beschwerden und für eine Bluttransfusion immer ins Krankenhaus muss, sondern in der Tagesklinik oder in den Gesundheitszentren, also möglichst in der Nähe des Wohnorts, versorgt werden kann. Eine weitere Neuerung, die gut angenommen wird: Die Tagesklinik hat bis 19:00 Uhr geöffnet – auch dadurch landen weniger Patient:innen im Krankenhaus. Vor allem jüngere Patient:innen schätzen das, weil sie regelmäßig zu Hause schlafen können, wie der Professor betont.
Miteinander auf Augenhöhe
Der Professor legt großen Wert auf eine kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe – und zwar nicht nur mit Ärzt:innen, sondern „auch mit der Pflege“, wie er sagt. Denn: „Wer die Pflege verliert, verliert die ganze Medizin.“ Das bestätigt auch Sonja Klenkhart, die Stationsleiterin: „Die Harmonie, die wir haben, liegt an der Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir haben hier ein fast freundschaftliches Verhältnis, das von den Mitarbeiter:innen geschätzt wird.“
Für Professor Keils und Klenkharts Haltung gibt es Unterstützung von oben – also von der kollegialen Führung des Krankenhauses, der ärztlichen Direktion, der Pflegedirektion und der Verwaltung, wie der Professor betont. „Die Menschen, die bei uns zu Schnuppertagen kommen, spüren den Spirit der Abteilung“, was Professor Keil stolz macht: „Wir haben gemeinsam und auch durch die Unterstützung der Stadt eine Versorgung geschaffen, die mich überdauern wird, weil wir auch die Qualität und Kapazität gesteigert haben.“
„Für österreichische Verhältnisse geht es hier auch sehr gut, neue Konzepte zu entwickeln, was sehr angenehm ist“, sagt er. Er braucht dafür in der Regel ein bis zwei Jahre. Was ihn an seiner Arbeit am meisten freut, ist das Feedback der Patient:innen: „Viel Lob, wenig Tadel.“
„Es ist wichtig, dass man als Spezialist zeigt, was geht. Die Innovationen müssen aus dem Bereich kommen. Dafür bekomme ich mein Geld“, betont der Hämatologe, und man würde insgesamt mehr aus der Medizin herausholen können, „wenn es öfter so übergreifende Systeme gäbe, wie wir es haben“.
Enormer Arbeitsdruck
Auch wenn in der Hämatologie auf den:die Besucher:in alles ruhig und professionell wirkt, gibt es doch auch enormen Arbeitsdruck. Der ist für Professor Keil auch ganz logisch, denn „wenn man etwas Gutes macht, herrscht immer ein gewisser Arbeitsdruck, weil man Zustrom hat“. Das Fachgebiet sei spannend, es gebe ein sehr gutes Klima, und daher blieben auch die Pfleger:innen sehr gerne. Und wenn der Druck allen einmal zu viel wird, „dann passen wir das an und lassen die Luft raus – wir lösen es gemeinsam“.
Menschlich gesehen
Dazu komme auch großer psychischer Druck – etwa dann, wenn Patient:innen nach vielen Monaten der intensiven und langen Behandlung sterben. Stationsleiterin Klenkart: „Wir lernen unsere Patient:innen hier sehr gut kennen. Manche sind ein Jahr bei uns. Das ist ein langer Zeitraum, in dem engere Verbindungen entstehen können. Wenn solche Menschen sterben, ist das belastend und traurig für uns. Wir besprechen das, verarbeiten es und lassen die gemeinsame Zeit Revue passieren.“

Noch größeren Arbeitsdruck gab es auf der Station während der Corona-Krise. Während der Pandemie wurde die Hämatologie-Station für Corona-Patient:innen geöffnet. „Da kamen dann auch etliche Freiwillige in unser Team. Aus dem ganzen Haus wurden Mitarbeiter:innen bei uns zusammengezogen. Es gab damals eine Euphorie in unseren Teams, weil es etwas Neues war“, erinnert sich Keil.
Natürlich sei es auch zu Ausnahmesituationen gekommen, schildert Stationsleiterin Sonja Klenkhart: „Auch wenn während der Pandemie sehr viel sehr schnell organisiert wurde: Durch Krankenstände und Verpflichtungen zur Kinderbetreuung ist es auch bei uns immer wieder zu Personalausfällen gekommen. Kolleg:innen haben dann auf freiwilliger Basis Zusatzdienste gemacht – es gab aber auch immer wieder Phasen, in denen Gutstunden auch abgebaut werden konnten.“ „Der Zusammenhalt in der Krise wurde nicht weniger, sondern sogar besser,“ ergänzt Betriebsratsvorsitzende im Hanusch-Krankenhaus, Gerlinde Kandler. Um die Folgen von Personalausfällen zu dämpfen, so Kandler, hatten sie immer gesundes Personal, das in Bereitschaft stand: „Trotz Stress springen auch jetzt die Leute ein und lassen die Patienten nichts davon merken.“
Sterben bei COVID
„Das Sterben bei COVID war fürchterlich“, sagt Klenkhart: „Viele Menschen sind alleine gestorben oder im Beisein der Ärzt:innen und Pfleger:innen. Die Verstorbenen hübsch zu machen, sodass sich die Angehörigen von ihnen hätten verabschieden können, war in dieser Zeit aufgrund der Infektionsprophylaxe nicht möglich.“
„Unseren Mitarbeiter:innen haben wir regelmäßig Supervision angeboten, also psychologische Betreuung mit ärztlicher Begleitung“, wie Professor Keil ergänzt. „COVID hat unsere Abteilung nicht zerlegt“, sagt Keil, „es war zwar schwierig, aber es ist sich ausgegangen. Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen und haben viel gelernt.“ Aus der Sicht von Nell-Duxneuner, der ärztlichen Direktorin im Hanusch-Krankenhaus, „gab es hier eine besonders hohe Qualität der Patient:innenversorgung, die die Innovationskraft des Hanusch-Krankenhauses gezeigt hat“.

Die Arbeit auf der Station geht weiter
Nach dem Mittagessen finden die Sitzvisiten des Pflegepersonals mit den Ärzt:innen statt. Alles, was bei den Visiten besprochen wurde, wird jetzt noch einmal wiederholt. Die Belegschaft überarbeitet die Planung. Am Nachmittag finden die Therapien für die Neuaufnahmen statt. Chemotherapie oder eine Vitalparameterrunde. Um 15:00 Uhr gehen der Aufnahmedienst und die Stationsleitungen nach Hause. Um 19:00 Uhr ist die Dienstübergabe an den Nachtdienst.
Am Ende des Tages sitzt Professor Felix Keil zufrieden in seinem Dienstzimmer: „Die Abteilung ist gut besetzt. Es gibt keinen offenen Dienstposten“, sagt er. Draußen ist es längst dunkel geworden, und er arbeitet jetzt an den Ergebnissen seiner Forschung. „Wir haben aufgrund der vielen Menschen, die wir hier in der Hämatologie behandeln, repräsentative Zahlen.“ Die wird er heuer auf einem Fachkongress in den USA vorstellen. Der Professor wirkt jetzt entspannt. „Ich muss sagen, wir haben das mit der integrierten Versorgung gar nicht schlecht gemacht. Es ist eine nette Arbeit, und ich gehe gerne ins Hanusch-Krankenhaus.“ Und neue Ideen? Nach dem Ende der Pandemie will er neue Ideen verwirklichen.