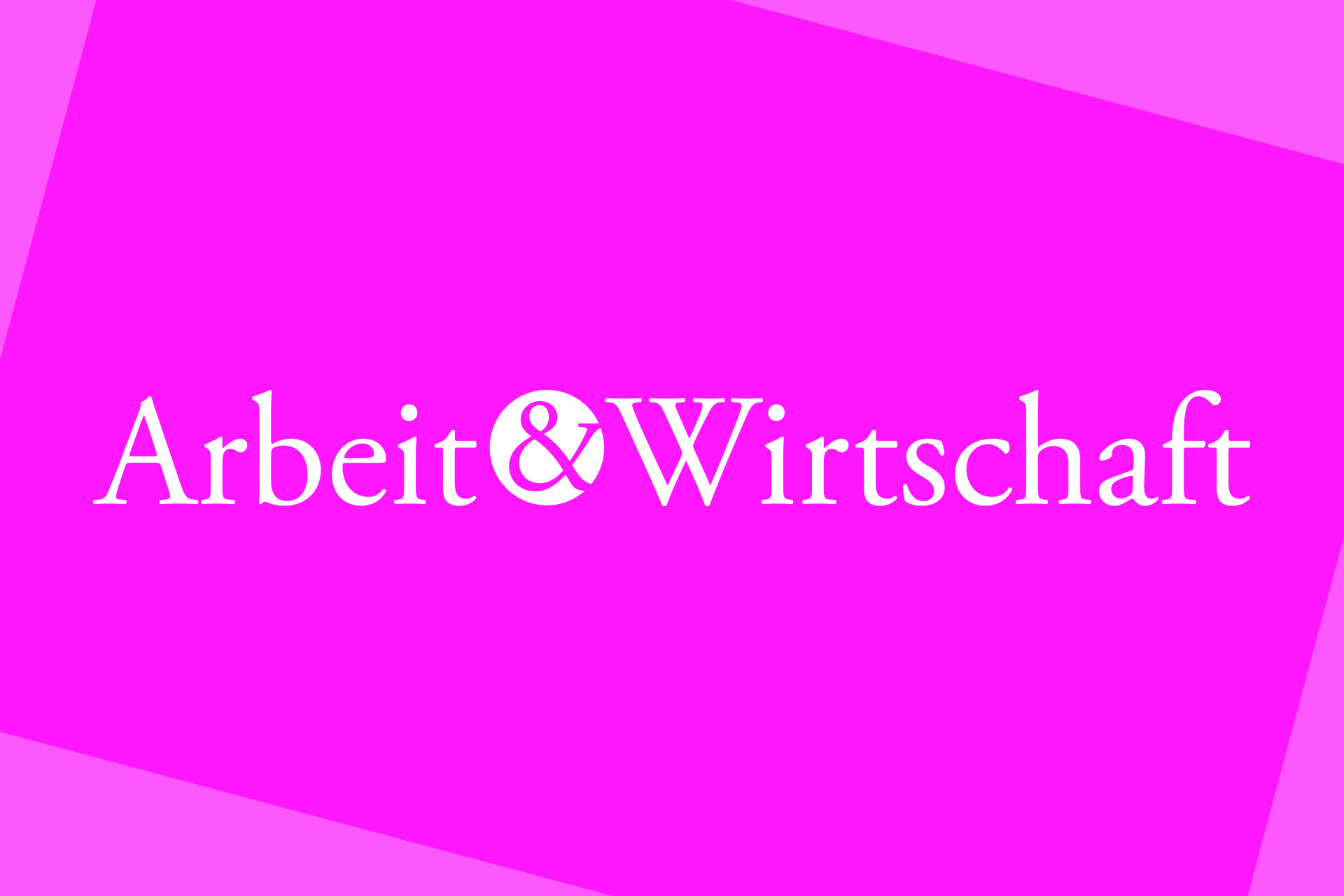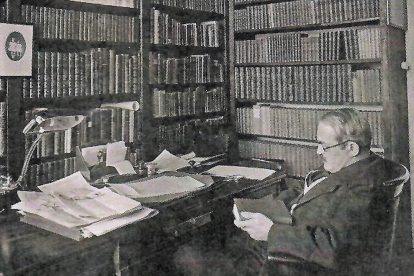Fast 30 Jahre nach dem ersten Frauenstreik gingen Hunderttausende Schweizerinnen für mehr Zeit, Lohn und Respekt auf die Straße.
Vor 100 Jahren wurde die Internationale Arbeitsorganisation gegründet. Sie legt weltweit Mindeststandards für die Arbeitswelt fest und überwacht deren Einhaltung.
Das heutige Wirtschaftssystem beruht auf Ausbeutung, die auch den Mittelschichten weltweit zu mehr Wohlstand verhilft.
Umso wichtiger sind internationale Solidarität und die internationale Arbeit der Gewerkschaften.
Auf Dauer muss sich aber das System ändern.
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
uropa kann doch nicht alle aufnehmen: Dieses Argument wird gerne als Begründung verwendet, warum man die Grenzen dichtmachen müsse. Das Ding ist: So einfach kann man es sich in Europa nicht machen. Denn es ist eine Tatsache, dass Europa dazu beiträgt, dass Menschen anderswo die Flucht ergreifen. Nicht wegen der tollen Sozialleistungen, wie es sie in Österreich (noch?) durchaus gibt, was auch gerne behauptet wird. Ein viel wichtigerer Aspekt aber ist, dass auch wir in Österreich von einem Wohlstandsmodell profitieren, das darauf basiert, dass Menschen an anderen Orten der Welt ausgebeutet werden und/oder ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird.
Unsolidarisches System
Man darf sich keine Illusionen machen: Dass der Wohlstand insgesamt gewachsen ist, ist ein Ergebnis dieses wahrlich unsolidarischen Wirtschaftssystems. Ob es das alltägliche Smartphone ist, für das Rohstoffe unter elenden Bedingungen inklusive Kinderarbeit abgebaut werden. Ob es Obst oder Gemüse ist, das ArbeiterInnen – im Übrigen mitunter auch in Österreich – unter unwürdigen Bedingungen ernten. Ob es Kleidung ist, die Menschen in Asien in Sweatshops ebenfalls unter schrecklichen Bedingungen herstellen. Dass Menschen vor solchen Bedingungen flüchten, kann man ihnen kaum verdenken. Allerdings sei hier auch betont: Es ist keineswegs so, dass alle nach Europa kommen. Ganze 84 Prozent der Flüchtlinge leben nämlich in Staaten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Deshalb ist auch das eine Frage der internationalen Solidarität, dass der reiche Kontinent Europa seinen – vergleichsweise kleinen – Teil der internationalen Migration schultert.
Es ist eine Frage der internationalen Solidarität, dass der reiche Kontinent Europa seinen – vergleichsweise kleinen – Teil der internationalen Migration schultert.
Ja, können wir uns das denn leisten, wir dann als Nächstes gefragt. Diese Frage darf man nicht nur mit dem Hinweis beantworten, dass es sich auch ärmere Regionen leisten müssen. Denn in der Tat haben wir auch in Europa ein Gerechtigkeits- bzw. besser gesagt: ein Verteilungsproblem. Denn wer bezahlt denn all die staatlichen Maßnahmen, die es zur Bewältigung von Migration wie Integration braucht? Nun, es sind in erster Linie die arbeitenden Menschen, denn von ihnen werden die staatlichen Budgets zu einem Großteil finanziert.
So ist der Steuerkuchen in Österreich sehr ungleich verteilt: Mehr als 80 Prozent kommen aus Arbeit und Konsum. Der Rest stammt aus Kapitaleinkünften, Gewinnen und Vermögen – und gerade hier herrscht auch in Österreich eine enorme Ungleichheit. Gleiches gilt, was die Aufnahme der MigrantInnen betrifft. Denn wer muss das denn bewältigen? Aufgrund des ungleichen Bildungssystems sind es dann oft SchülerInnen in Schulen, denen ohnehin an allen Ecken und Enden die Mittel fehlen, um die Kinder gut auf die Zukunft vorzubereiten. Am Arbeitsmarkt sind es jene ArbeitnehmerInnen, die ohnehin schon unter Konkurrenzdruck stehen und wenig verdienen. Das rechtfertigt keinesfalls fremdenfeindliche Antworten, denn erstens lenken diese nur vom eigentlichen Thema ab. Zweitens sind MigrantInnen die Letzten, die dafür verantwortlich sind, dass das System so ist, wie es ist. Vielmehr sind sie es, die Konsequenzen dieses unfairen Systems als Erste zu spüren bekommen haben.
Die gute alte Systemfrage
Internationale Solidarität bedeutet also weitaus mehr, als Hilfsprogramme aufzulegen oder verantwortlich einzukaufen. Es muss bedeuten, das System selbst infrage zu stellen. Aber kann ich das denn als Einzelperson? Nun ja, zweifellos ist die Macht, die Individuen haben, sehr beschränkt. Aber machtlos ist das Individuum keineswegs. Es kann sowohl verantwortlich einkaufen als auch in Betrieben für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Gewerkschaften spielen hier eine sehr wichtige Rolle, denn sie sind es, die die Verteilungsfrage sowohl im In- als auch im Ausland stellen können und müssen. Denn was ist ein gutes Leben für alle in Europa wert, wenn es auf einem schlechten Leben von anderen beruht, die das Pech hatten, woanders geboren worden zu sein – ganz abgesehen davon, dass sich viele von ihnen mit dem Wunsch nach einem besseren Leben auf den Weg nach Europa machen.
Die „Internationalen Berufssekretariate“ der Gewerkschaften waren die erste Antwort auf die Globalisierung der kapitalistischen Wirtschaft.
Die Zunahme atypischer Beschäftigungsverhältnisse und unterbrochene Erwerbslaufbahnen stellen Arbeitsmarkt und Pensionssystem vor neue Herausforderungen: Eine Erwerbslücke von einem Jahr reduziert die Monatspension bereits um rund 2,8 Prozent.
Wie lange muss gearbeitet werden, um eine Alterspension zu erreichen? Und sind unsere Pensionen noch sicher? Ja. Wolfgang Panhölzl, Abteilung Sozialversicherung der Arbeiterkammer Wien, klärt im Interview auf.
Wer schwer körperlich arbeitet, kann früher ohne Abschläge in Pension gehen. So einfach sich die Hacklerregelung beschreiben lässt, so kontrovers wird sie diskutiert und so komplex ist sie geregelt. Ein Überblick.
Reformen, Reformen und noch einmal Reformen – seit der Einführung der Pensionsversicherung wurden die gesetzlichen Bestimmungen häufig geändert. Wir geben einen Überblick über die Entwicklung der österreichischen Pensionsversicherung.