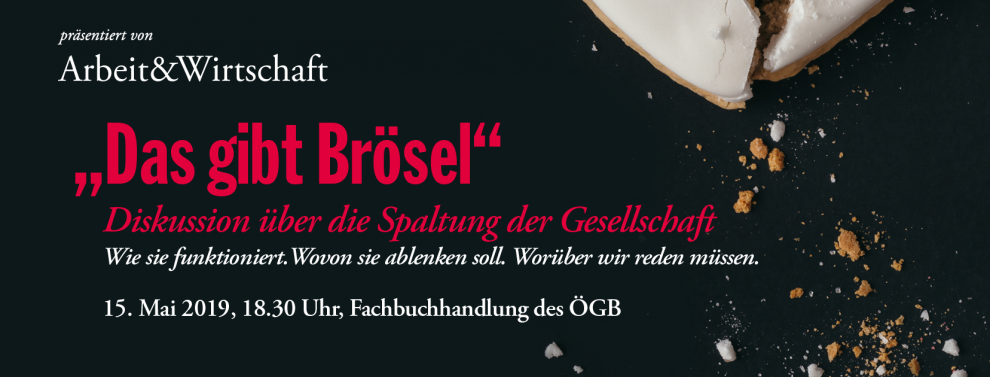Mit der Einteilung der Gesellschaft in „wir“ und „die anderen“ und dem gekonnten Schüren von Emotionen wollen PopulistInnen von den eigentlichen Problemen ablenken: der ungleichen Verteilung von Wohlstand, den dramatischen Folgen von Sozialabbau für die Menschen und der Schlechterstellung von Frauen und MigrantInnen. Dem gilt es entgegenzutreten.
Spaltung der Gesellschaft
Dieser Schwerpunkt erschien im Mai 2019 in der Ausgabe 04/2019 der Arbeit&Wirtschaft.
Soziologin Laura Wiesböck von der Universität Wien hat beobachtet, dass in unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen mehr übereinander geschimpft, statt miteinander gesprochen wird. Viele nehmen politische Auffassungsunterschiede als feindselig wahr. Für die Gesellschaft hat das gravierende Folgen.
Daniela Brodesser und Sarah Zeller mussten selbst erleben, was Leben in Armut bedeutet. Beide engagieren sich heute für Armutsgefährdete. Die eine bemüht sich um ein besseres Bewusstsein für die Lebensrealität dieser Menschen und geht gegen Vorurteile an. Die andere hat eine Beratungsstelle für Alleinerziehende auf die Beine gestellt, die sich auch dafür einsetzt, dass deren Bedürfnisse im Wohnbau besser berücksichtigt werden.
Wenn anderen etwas weggenommen wird, befriedigt dies manche, die selbst vom Sozialstaat unterstützt werden. Nur warum? Und wem nützt es wirklich?
Aus Integrationspolitik wurde Desintegrationspolitik. Dies verschärft die gesellschaftliche Spaltung und wird die Gesellschaft viel kosten.
Spaltung braucht Unterschiede. So ist die „Verschiedenheit von Mann und Frau“ Grundlage für eine Regierungspolitik, die wenig von freier Entfaltung hält.