Dafür gibt es Gründe. Die Anhebung des Eintrittsalters basiert auf dem Gleichbehandlungsgesetz von 1979. Es regelt unter anderem, dass Männer und Frauen in der Arbeitswelt gleichgestellt sein müssen. Dazu gehört auch der Pensionsantritt. Der Grundgedanke war, dass Frauen, die ab 1979 anfangen zu arbeiten, nach 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Pension gehen können. Deswegen beginnt die Anhebung im Jahr 2024 und wird bis 2034 stufenweise durchgeführt.
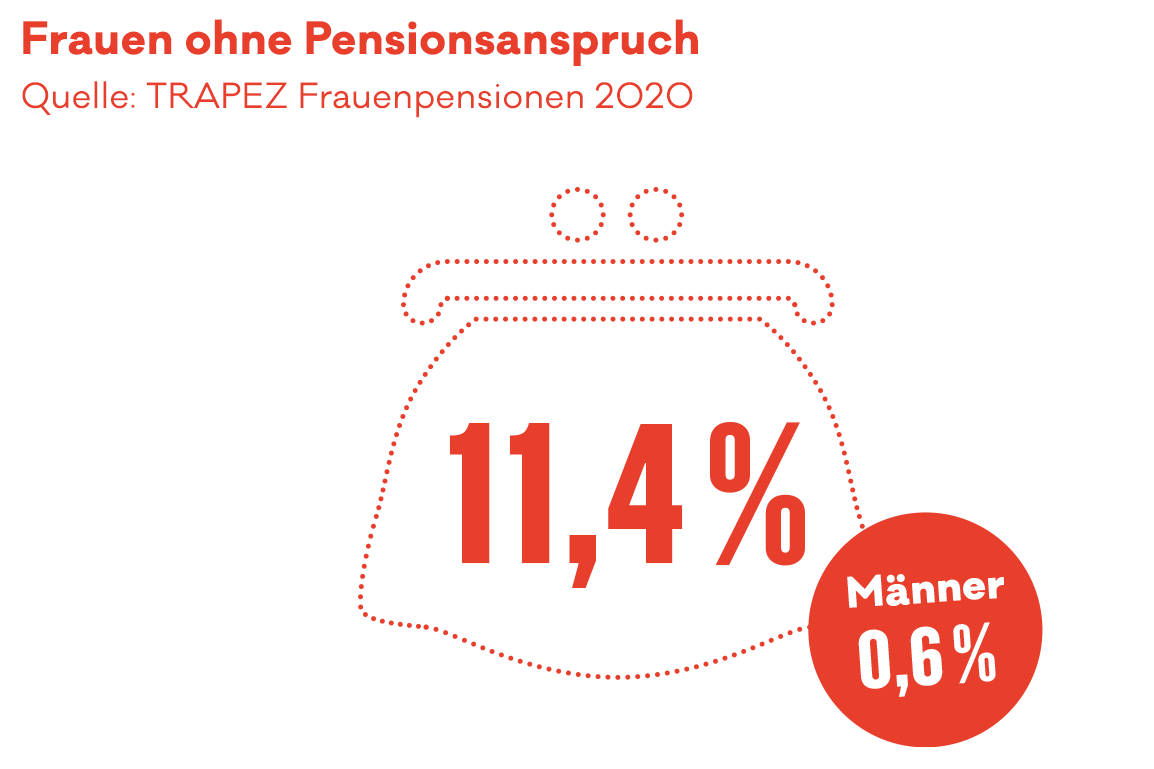
Die Idee dahinter war, dass im Jahr 2024 erstmals eine Generation Frauen in Pension geht, die eine Erwerbskarriere hinter sich hat, die juristisch betrachtet vollkommen gleichberechtigt ist. In der Praxis ist diese Gleichstellung allerdings noch nicht angekommen. Frauen in Österreich erledigen doppelt so viel unbezahlte Arbeit wie Männer. Sie haben mehr Teilzeitstellen und eher schlecht bezahlte – und körperlich anstrengende Branchen wie Gesundheit, Pflege und Reinigung sind frauendominiert.
In diesen Bereichen zweifelt eine überwältigende Mehrheit der Frauen an, überhaupt 45 Jahre arbeiten zu können. 73 Prozent sind es in der Altenpflege und Behindertenbetreuung und 66 Prozent der Reinigungskräfte. „Bei Frauen gibt es das Problem, dass sie auch aufgrund der Mehrfachbelastung unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leiden und nicht bis zum Pensionsantrittszeitpunkt erwerbstätig sein können“, fasst Christine Mayrhuber die Situation zusammen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsmarkt, Einkommen und soziale Sicherheit“ am Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO).
Die Altersarbeitslosigkeit ist in Österreich enorm hoch. Das ist eine schlechte Voraussetzung für die Anhebung des Eintrittsalters. Hier sind die Betriebe gefordert, ihrer weiblichen Belegschaft eine längere Beschäftigung zu ermöglichen.“
Christine Mayrhuber, WIFO
Das ist ein Grund für die hohe Altersarbeitslosigkeit in Österreich. Von 2010 bis 2020 hat sich die Zahl arbeitsloser Menschen, die älter sind als 50 Jahre, von 52.000 auf über 126.000 mehr als verdoppelt. Für Mayrhuber sind das katastrophale Rahmenbedingungen: „Die Altersarbeitslosigkeit ist in Österreich enorm hoch. Das ist eine schlechte Voraussetzung für die Anhebung des Eintrittsalters. Hier sind die Betriebe gefordert, ihrer weiblichen Belegschaft eine längere Beschäftigung zu ermöglichen.“
Doch genau daran scheitere es. Eine Umfrage der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) hat gezeigt, dass Betriebe auf die Anhebung des Pensionseintrittsalters noch gar nicht vorbereitet sind. „Die Wirtschaftskammer fordert immer die Erhöhung des Rentenantrittsalters, die Betriebe haben offensichtlich die gültige Regelung aber in der Personalpolitik nicht in ihrem Planungshorizont. Das ist erstaunlich“, kritisiert Mayrhuber.

Erhalt der Arbeitsfähigkeit geboten
Dabei gäbe es Lösungen. Zum einen die Beratung „fit2work“, die Unternehmen hilft, die Arbeitsfähigkeit ihrer Mitarbeiter:innen zu erhalten – durch die Minimierung körperlicher und seelischer Belastung. Hier gebe es aber einen Selection-Bias, erklärt Mayrhuber. Es kämen überwiegend Unternehmen, bei denen ohnehin ein Bewusstsein für die Thematik da sei. Wo der Hebel angesetzt werden muss, ist dank Berechnungen des WIFO allerdings klar. Zwei Faktoren beeinflussen diese Statistik besonders. Zum einen die Branche, in der Frauen arbeiten. Im Gesundheits- und Sozialwesen tritt nur die Hälfte der Frauen direkt in die Pension ein. Sogar nur 25 Prozent sind es in der Beherbergung und Gastronomie. Die häufigsten Direktübertritte (70 Prozent) gibt es in der öffentlichen Verwaltung.
Der zweite Faktor ist die Unternehmensgröße. In Betrieben, in denen weniger als zehn Beschäftigte arbeiten, geht nur ein Drittel der Frauen direkt in Alterspension. Hat die Firma mehr als 1.000 Beschäftigte sind es allerdings mehr als zwei Drittel. Die Frauen, die nicht direkt aus dem Beruf in die Pension gehen, sind im Durchschnitt 81 Monate arbeitslos, bevor sie in den Ruhestand können. Also beinahe sieben Jahre.
Jetzt in die Zukunft planen
Die Politik kann in diesem Fall wenig tun, außer in Betrieben der öffentlichen Hand – also in vielen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen – mit gutem Beispiel voranzugehen. Schon das scheint schwer genug. Vielmehr seien die Firmen gefragt, sich der Situation und der Folgen bewusst zu werden. Mayrhuber deutlich: „Wir brauchen jetzt eine Diskussion. Die Betriebe haben die Pandemie überlebt, hatten aber davor schon das Problem, nur sehr kurzfristig zu planen: in Quartals- und Jahreszahlen. Die Veränderung der Beschäftigungsstruktur hat aber einen Planungshorizont von mindestens fünf Jahren, um hier vernünftige Maßnahmen setzen zu können.“




