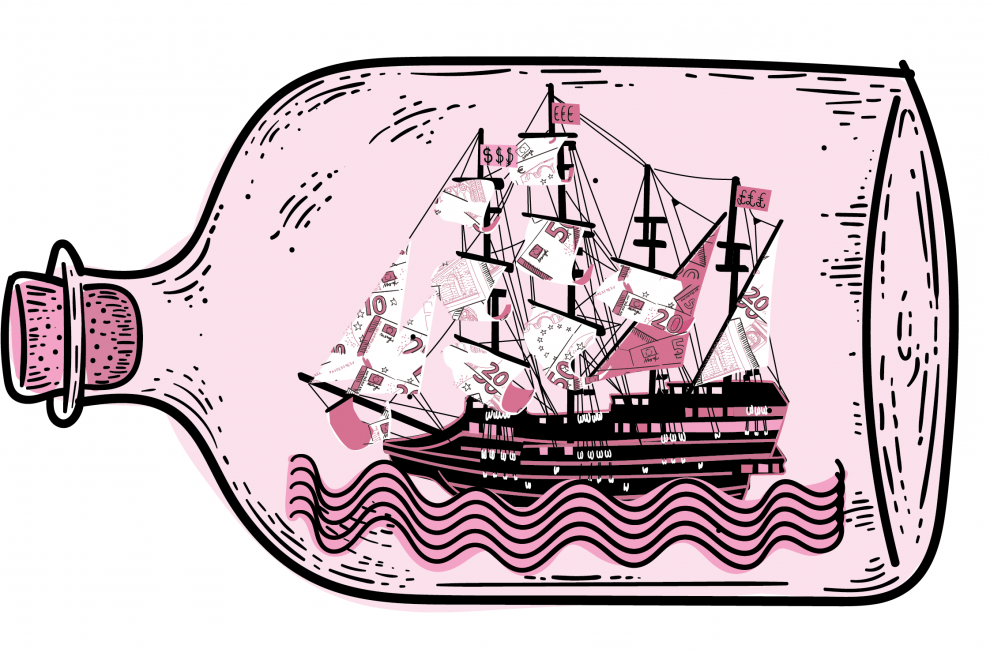Es sind Tomaten aus der Europäischen Union, meist aus Süditalien, die im westafrikanischen Ghana zu Spottpreisen vertrieben werden. Zu Preisen, die den ghanaischen Tomatenbauern den wirtschaftlichen Garaus machen. Denn sie erhalten – im Unterschied zu europäischen Agrarkonzernen – keine Subventionen und sind den europäischen Dumpingpreisen ausgeliefert.
Es sind ghanaische Tomatenbauern, die dann bar ihrer ökonomischen Existenz als sogenannte „Wirtschaftsflüchtlinge“ übers Mittelmeer in die EU kommen. Und es sind ghanaische Tomatenbauern, die unter sklavenähnlichen Bedingungen auf Süditaliens Feldern Tomaten ernten. Tomaten, welche in ihr Heimatland exportiert werden. Tomaten, die „Kugeln im Roulette der unfairen globalen Handelspolitik“, wie es im Vorspann der Doku „Displaced: Tomaten und Profitgier – Ghanas Bauern auf der Flucht“ heißt.
Politische Macht zu Papier
Die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Ghana sind in einem Economic Partnership Agreement (EPA) verbrieft, welches – angeblich zu beider Vorteil – den Handel zwischen den Vertragspartnern liberalisieren soll. Liberalisieren, das klingt nach Freiheit. „Doch frei ist da eigentlich wenig“, erklärt Henrike Schaum, Referentin der Abteilung EU und Internationales der AK Wien. Vielmehr sichert sich die EU – unter dem Deckmäntelchen des Freihandels – mittels solcher Verträge den Zugang zu wichtigen Rohstoffen und Märkten. „Derlei Handelsverträge verfestigen und intensivieren bestehende Ungleichgewichte“, so Schaum.
Es sind politische Machtverhältnisse, Herrschaftsbeziehungen, die in diesen Handelsverträgen zu Gesetzen gerinnen – ausformuliert und zu Papier gebracht von einem EU-Beamt*innenapparat, der in die Tausende geht. Und die Ressourcen ihrer Vertragspartner*innen bei Weitem übersteigt. „Solche Abkommen werden hinter verschlossenen Türen verhandelt, ohne Parlamente, zivilgesellschaftliche Akteure oder Gewerkschaften ernsthaft miteinzubeziehen und ohne soziale und ökologische Kosten zu berücksichtigen“, kritisiert Schaum. Ein Beamt*innenapparat, der zuvorderst Kapitalinteressen verfolgt.
Doch die sogenannten Freihandelsverträge sind nur der papiergewordene Ausdruck einer viel umfassenderen Abhängigkeits- und Unterdrückungsbeziehung zwischen den Ländern des globalen Nordens und des globalen Südens. Die historischen Wurzeln dieser Beziehungen liegen Jahrhunderte zurück. „Die Ausbeutung von Rohstoffen war von Anfang an eine Antriebsfeder des Kolonialismus“, erklärt Karin Küblböck, Ökonomin an der Österreichischen Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung (ÖFSE).
In der Literatur ist vom „Ressourcenfluch“ die Rede. Zwar besitzen Länder wie die Demokratische Republik Kongo oder Chile reiche Vorkommen an sogenannten „strategischen Rohstoffen“ wie Kobalt oder Lithium – Mineralien, die für die Produktion von Smartphones oder Elektro-Autos unverzichtbar sind. Doch die Verarbeitung und damit die Wertschöpfung findet in anderen Ländern statt. Dadurch werde die Abhängigkeit von Rohstoffexporten fortgeschrieben, so Küblböck.
Dass die meisten rohstoffreichen Länder zu wenig von diesem Reichtum profitieren, liegt zum einen an stark schwankenden Rohstoffpreisen, erklärt die Expertin für Rohstoffpolitik und internationalen Handel. Devisen- und Steuereinnahmen sind dadurch in hohem Maße von Entwicklungen abhängig, die ein Staat selbst nicht beeinflussen kann. Durch die „Finanzialisierung“ des Rohstoffhandels – also den gestiegenen Einfluss von Finanzinvestoren – hat diese Dimension noch einmal an Bedeutung gewonnen.
Das Schicksal ganzer Staaten liegt somit zu einem beträchtlichen Teil in den Händen einer Art überirdischer Kraft namens Markt. Fällt die Kaffee-Ernte in Brasilien überdurchschnittlich gut aus, muss der Kaffeebauer in Uganda um seine Existenz fürchten, denn das brasilianische Mehrangebot drückt den Preis. Je niedriger die Temperaturen in Brasilien, desto üppiger das Abendessen in Uganda.
Charakteristisch für den globalen „ungleichen Tausch“ ist andererseits die Tatsache, dass niedrig entlohnte, arbeitsintensive Produktionsschritte und Rohstoffextraktion tendenziell im globalen Süden stattfinden, erklärt Karin Fischer, Leiterin des Arbeitsbereichs Globale Soziologie und Entwicklungsforschung an der Johannes Kepler Universität Linz, während wissensintensive Tätigkeiten im globalen Norden abgewickelt werden. Doch Profite werden am Ende, nicht am Anfang der Wertschöpfungskette erzielt: „In den Konzernzentralen verbleibt der höchste Gewinn.“

Gewalt und Morde
Regionen und Standorte werden nicht zufällig, sondern „selektiv“ in den Weltmarkt eingebunden, erklärt Fischer. Auf der Suche nach „Standortvorteilen“ sieht sich das Kapital nach Produktionsstätten um, an denen Arbeitskosten und Arbeitnehmer*innenschutz minimal sind. Gerade der Rohstoffabbau ist ein enorm gewalttätiger Sektor, in welchem oft Militär oder private Sicherheitsdienste die Produktionsbedingungen sichern und regelmäßig Aktivist*innen verschwinden. Laut der Organisation Global Witness wurden im Jahr 2019 weltweit 212 Umweltaktivist*innen ermordet, so viele wie nie zuvor.
Hinzu kommt der sogenannte „ökologisch ungleiche Tausch“. „Die Produkte, die wir konsumieren, hinterlassen am Ort der Extraktion großen Schaden – durch Eingriffe in die Natur, Verschmutzung, Emissionen, enormen Land-, Wasser- und Energieverbrauch“, so Fischer. Schäden und Emissionen, die in der europäischen oder der österreichischen Umweltbilanz nicht auftauchen, obwohl die Produkte für den Export produziert werden.
Gleichzeitig wollen wir alle irgendwie teilhaben, dazugehören. Uns modisch kleiden, per Smartphone kommunizieren, ein Einfamilienhaus bewohnen, in den Urlaub fliegen. Oder sind beispielsweise auf ein Auto angewiesen, weil das öffentliche Verkehrssystem unzureichend ausgebaut ist. Oder greifen im Supermarkt zum Billigfleisch, weil das eigene Budget nicht mehr hergibt. Auch wenn das vielleicht dem eigenen ökologischen oder moralischen Gewissen widerspricht.
Die Politikwissenschafter Ulrich Brand von der Universität Wien und Markus Wissen von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin sprechen in diesem Zusammenhang von einer „imperialen Produktions- und Lebensweise“. Die Art und Weise, wie wir im globalen Norden produzieren und konsumieren, basiert zu großen Teilen auf der „Externalisierung“ der sozialen und ökologischen Kosten dieser Produktions- und Lebensweise. Kurz: Andere bezahlen anderswo die Rechnung für unseren Wohlstand, für unser ganz normales Leben.

von Anfang an eine Antriebsfeder des
Kolonialismus“, sagt Karin Küblböck,
ÖFSE-Ökonomin über die Wurzeln
der Freihandelsabkommen.
Irgendwer, irgendwo
Dabei ist Österreich, trotz überschaubarer Größe, ein nicht zu vernachlässigender Akteur. Pro Kopf und Tag hat eine in Österreich lebende Person laut einem Bericht des Umwelt- und Landwirtschaftsministeriums einen Material-Fußabdruck von 71 Kilogramm. Österreich steht damit EU-weit an fünfter Stelle. Jedoch werden nur 50 Kilogramm davon innerhalb der österreichischen Grenzen verursacht. Noch deutlicher ist die Diskrepanz beim Wasserverbrauch: Von den knapp 4.400 Litern pro Kopf und Tag, die hierzulande durch Konsum induziert werden, wird nur ein Sechstel direkt in Österreich verbraucht. Auch hier gilt: Die Rechnung zahlen andere anderswo – irgendwer, irgendwo.
Wenn von Resilienz die Rede ist,
tritt die Frage nach den Ursachen
in den Hintergrund.
Stefanie Graefe, Soziologin
All das, „die Ungleichheitsbeziehungen in unseren alltäglichen Produkten“, deren soziale und ökologische Folgen, können wir uns nicht bei jedem Supermarktbesuch vergegenwärtigen – „das ist nur durch Abspaltung und Verdrängung möglich“, erklärt Soziologin Fischer. Inmitten dieser „Vielfachkrise“, der ökologischen, politischen, wirtschaftlichen, gesundheitlichen und sozialen Krise(n), ist daher vielfach von „Resilienz“ die Rede. Stefanie Graefe, Privatdozentin und Soziologin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, beobachtet, wie sich in den letzten Jahren ein ganzer Markt an Ratgeberliteratur, Dienstleistungen und Workshops um das Thema „Resilienz“ entwickelt hat. Eine Tendenz, die Graefe überaus kritisch sieht: „Wenn von Resilienz die Rede ist, tritt die Frage nach den Ursachen in den Hintergrund.“ Dann steht einzig die Frage nach der Wiederherstellung des Status quo im Fokus. Versuche, diese Krisenphänomene als Symptome einer größeren, systemischen Dysfunktionalität zu betrachten, werden dadurch vereitelt.
Die COVID-19-Pandemie, so Graefe, sei ein treffendes Beispiel: Längst ist bekannt, dass eine globalisierte Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, industrielle Massentierhaltung und die sukzessive Zerstörung tierischen Lebensraums die Wahrscheinlichkeit für Pandemien erhöht. Virolog*innen warnen seit Jahrzehnten davor. Doch nach einigen Wochen allgemeiner Verunsicherung und Orientierungslosigkeit war spätestens im Mai vergangenen Jahres die Frage nach dem „Zurück-zur-Normalität“ diskursbestimmend. „Resilienz ist ein Krisenbewältigungskonzept, das grundsätzliche – aber notwendige – Strukturfragen verdrängt“, kritisiert Graefe. Graefe spricht von Resilienz als einem „unpolitischen Konzept, mit tendenziell konservativer und systemstabilisierender Ausrichtung“.
Neben uns die Sintflut
Es gibt noch einen weiteren Punkt, der eine politische Auseinandersetzung um die Ungleichheitsbeziehungen zwischen globalem Norden und Süden verhindert. „Den eigenen Wohlstand zu wahren, indem man ihn anderen vorenthält, ist das unausgesprochene und uneingestandene Lebensmotto der ‚fortgeschrittenen‘ Gesellschaften im globalen Norden – und ihre kollektive Lebenslüge ist es, die Herrschaft dieses Verteilungsprinzips und die Mechanismen seiner Sicherstellung vor sich selbst zu verleugnen“, schreibt der Soziologe Stephan Lessenich in seinem Buch „Neben uns die Sintflut“. Laut Lessenich existieren eine Vielzahl an Legitimationserzählungen, die die himmelschreienden Ungerechtigkeiten ideologisch retuschieren und für den Einzelnen somit psychologisch verdaubar machen. Lessenich spricht von einem verallgemeinerten „Nicht-wissen-Wollen“: der Versuch, das Wissen oder zumindest die Ahnung um die Ausbeutung anderer Weltregionen vom „kollektiven Gefühlsleben“ abzutrennen. Einer dieser Versuche besteht im bereits angesprochenen Euphemismus „Freihandel“, der impliziert, hier handle es sich um einen Austausch unter „Gleichen“, jedem Land stünde also offen, das Beste aus seiner Situation zu machen.
Ein weiterer Verdrängungsmechanismus besteht laut Lessenich in rassistischen Stereotypen: Die da könnten es eben nicht besser. Würden eben nicht so viel leisten wie wir. Seien selbst schuld an ihrer misslichen Lage. Systemische Fragen und solche nach Macht- und Herrschaftsbeziehungen, also politische Fragen, werden dadurch ausgeblendet, verdrängt. Und die eigene privilegierte Position legitimiert.
Doch wie alles Verdrängte – und hier sind wir bei der Psychoanalyse angelangt – findet auch das der imperialen Lebensweise seinen Weg irgendwann zurück an die Oberfläche, zurück ins Bewusstsein. In Form einer ökologischen Krise, die sich nicht mehr nur in abstrakten Expert*innenprognosen und verklausulierten Klimaberichten manifestiert, sondern in Form von Überschwemmungen, Hitzesommern und Waldbränden immer konkreter wird. In Form von Migrant*innen, die ihrer ökonomischen Existenz beraubt im Mittelmeer zu Tausenden ertrinken, in griechischen Lagern dahinsiechen – oder in Süditalien als sogenannte „moderne Sklaven“ Tomaten ernten. Oder in Form einer Pandemie, die weltweit (laut offiziellen Zahlen der Johns Hopkins University) bisher 3,7 Millionen Opfer forderte und deren gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Folgen bis dato unabschätzbar sind.

Art Scheinrealität gelebt“, kritisiert
AK-Expertin Henrike Schaum. Wohlstand habe zu Verdrängung gravierender Probleme geführt.
Fragen nach dem „guten Leben“
„Wir haben über Jahrzehnte in einer Art Scheinrealität gelebt“, kritisiert AK-Expertin Henrike Schaum. Dass im globalen Norden die meisten zumindest etwas vom Wohlstandskuchen abbekommen haben, „hat gereicht, dass man die sozialen und ökologischen Verwerfungen, die diese Lebensweise mit sich bringt, verdrängen konnte. Wir haben uns lange auf ein falsches Versprechen eingelassen: Es werde nur Gewinner*innen geben. Doch letzten Endes haben nur wenige wirklich profitiert, während der Druck auf Arbeitsbedingungen und Löhne steigt und Umweltzerstörung zunimmt – sowohl im Norden als auch im Süden.“
Es ist an der Zeit zu fragen: Wie hoch sind die sozialen und ökologischen Kosten, für welchen – und für wessen – Nutzen? Denn während die Einkommens- und Vermögenszuwächse der letzten Jahrzehnte vor allem auf das Konto des weltweit reichsten Prozents gingen, ist es die breite Masse der weniger Privilegierten – im globalen Norden wie im Süden –, die am meisten von den ökologischen und sozialen Folgen betroffen ist.
„Wir wissen“, sagt Fischer, „dass steigender Materialkonsum ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu mehr Wohlstand führt.“ Fragen nach dem guten Leben müssten daher wieder verstärkt in den Fokus rücken, abseits von Wirtschaftswachstum und materiellem Besitz. Diese Fragen können nicht dem Einzelnen aufgebürdet und schon gar nicht über einzelne Konsumentscheidungen beantwortet werden – „es geht um eine politische Auseinandersetzung und die Veränderung von Strukturen!“, fordert Fischer.
Es gilt, die Roulette-Kugeln der globalen Handelspolitik nicht durch fair oder ökologisch gehandelte Tomaten auszutauschen – sondern die Spielregeln insgesamt zu ändern.
Drei Fragen zum Thema
an Ulrich Brand
Professor für Internationale Politik, Universität Wien
Sie haben den Begriff der „Imperialen Produktions- und Lebensweise“ entwickelt. Worum geht es dabei?
Wenn man in einem materiell wohlhabenden Land des globalen Nordens lebt, greift man systematisch auf Produkte zurück, die von billigen Arbeitskräften andernorts produziert wurden und für die häufig natürliche Ressourcen ausgebeutet wurden: T-Shirts, Handys, Autos. Aber auch hier kann von einer imperialen Lebensweise gesprochen werden, wenn Menschen zu unsäglichen Bedingungen in Fleischfabriken, Ernte oder Pflege und oft als migrantische Arbeitskräfte tätig sind.
Sie verweisen auf „Klassen-Akteure“. Wieso?
Die imperiale Lebensweise erweitert die Handlungsmöglichkeiten von Menschen mit großem Einkommen übermäßig stark: Wer entscheidet über die Investitionen, die Profite bringen sollen? Wer macht die Werbung und die Inhalte der Boulevardmedien, die Menschen verblöden sowie Gewinne und Macht sichern sollen? Die imperiale Lebensweise hat starke Klassenkomponenten. Aber: Es ist nicht nur ein Oben und Unten. Es ist auch ein Mitmachen, ein passiver Konsens.
Soziale und ökologische Nachhaltigkeit einzufordern heißt also, Herrschaftsverhältnisse infrage zu stellen?
Ja. Aktuell erleben wir das Gegenteil: Nachhaltigkeit zu fördern wird gleichgesetzt mit besserer Technologie, sozialen Innovationen, „grüner“ Produktion und „grünem“ Konsum. Dazu kommt eine Individualisierung der Verantwortung – die Einzelnen sollen über Kaufentscheidungen den Planeten retten oder auch nicht. Unternehmen sind fein raus. Die imperiale Lebensweise zu hinterfragen bedeutet auch, kapitalistische Verhältnisse und damit verbundene Klassenmacht, Ausbeutung, ungleiche Geschlechterverhältnisse, Rassismus und Naturzerstörung zu hinterfragen.