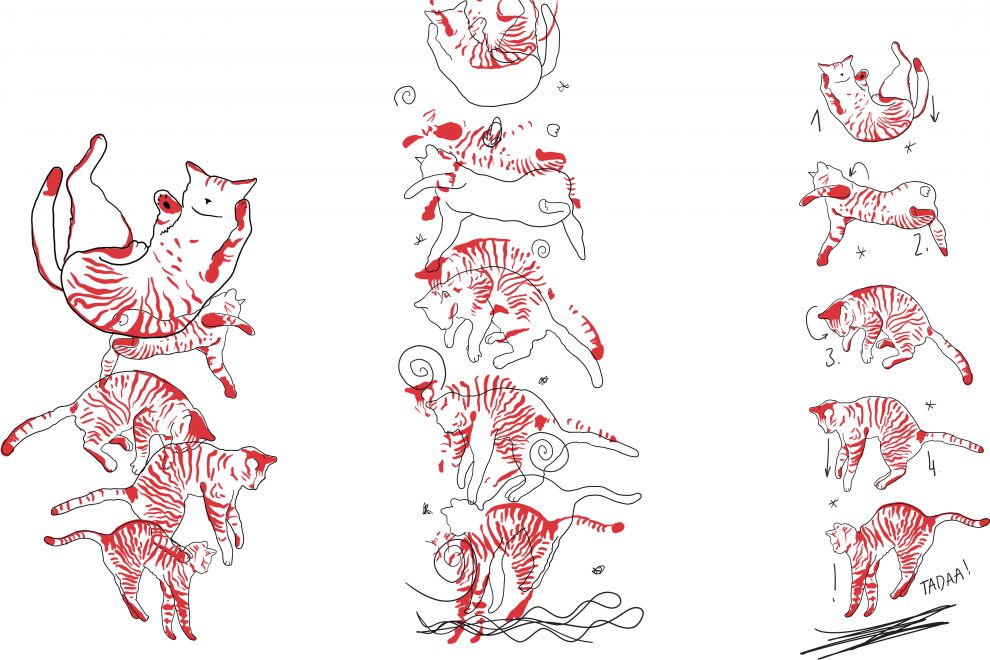Das haben wir am Sozialstaat: Er schützt vor krasser Not, lindert die ärgsten Ungerechtigkeiten, und wenn wir den Begriff „Sozialstaat“ in einem umfassenden Sinn verstehen (also nicht nur Arbeitslosen-, Kranken- und Pensionsversicherung und Ähnliches im Blick haben, sondern alle staatlichen Investitionen in Bildung, Infrastruktur, in Kultur, in Kindergärten, in Forschung, in Medizin), dann sorgt er für Aufstiegschancen, für die Entwicklung von Talenten, für Innovation.
Er hilft nicht nur einigen wenigen: denen, die es besonders schwer haben oder die arge Schicksalsschläge hinnehmen müssen – er hilft allen, so wie die allmählich, langsam steigende Flut, die alle Boote hebt. Und nicht nur die Luxusjachten.
Kurzum: Er nützt allen. Er nützt vor allem auch der Wirtschaft. Wenn manchmal Kapitalvertreter*innen sorgenvoll in Kameras blicken und fragen: „Können wir uns den Sozialstaat noch leisten?“, dann ist das pure Ideologie. Denn wir können uns ihn nicht nicht leisten. Ohne Sozialstaat wären wir alle, als Gesellschaft insgesamt, ärmer – und wir wären schutzlos gegen Krisen.
„Wir haben alle automatischen Stabilisatoren wirken lassen“, beschreibt etwa Olaf Scholz, der deutsche Finanzminister, Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat die Philosophie seines Hauses in diesen Corona-Krisentagen.
„Automatische Stabilisatoren“, das ist ein nüchterner, expertokratischer Fachbegriff aus der Wirtschaftswissenschaft – und er beschreibt ganz gut, wie sozialstaatliche Institutionen wirken. Was aber ist damit gemeint? Wenn die Wirtschaft in eine Krise gerät (sei das wegen einer Konjunkturabschwächung, sei das wegen einer nicht-ökonomischen Katastrophe wie jetzt eben in einer Pandemie), dann würde das sofort zu einer Abwärtsspirale führen. Konsument*innen würden weniger einkaufen, Geschäfte müssten zusperren, Firmen würden dann weniger investieren, die Maschinenbauer weniger Ausrüstungsgüter verkaufen – und die Beschäftigten würden entlassen. Wenn die Beschäftigten entlassen sind, haben sie kein Einkommen mehr und würden folglich noch weniger konsumieren – die Krise würde immer ärger. Wenn viele Menschen arbeitslos wären und nicht einmal mehr wüssten, wie sie ihre Familien ernähren sollen, würden zudem die Einkommen von jenen sinken, die noch Arbeit haben.
Auf eine solche Krise können Regierungen auf zwei unterschiedliche Weisen reagieren: Sie können etwa selbst Investitionen planen, etwa den Beschluss fassen, eine Brücke zu bauen, die Baufirmen Aufträge beschafft und Jobs für Bauarbeiter sichert. Diese Beschlüsse müssten von der Regierung „aktiv“ gefasst, die Planungen dafür langwierig angeschoben werden.
Anders ist das mit jenen Stabilisierungsmaßnahmen, die „automatisch“ wirken. Werden mehr Leute arbeitslos, beziehen mehr Leute „automatisch“ mehr Arbeitslosengeld.
„Automatische Stabilisatoren“ heißen diese Hilfen des Sozialstaates, weil sie einfach wirken, ohne dass irgendjemand einen Beschluss fassen muss. Das hat natürlich einige Vorteile: Erstens wirken sie vom ersten Tag an, sie haben keine Verzögerung. Zweitens sorgen sie dafür, dass der Absturz nicht in ein tiefes Loch führt und immer ärger wird; und drittens bügeln sie regionale Ungleichheiten aus – gibt es in einem Bundesland mehr Erwerbsarbeitslose, fließt auch mehr Arbeitslosengeld dorthin, ohne dass es beispielsweise komplizierte Verhandlungen zwischen Landeshauptleuten bräuchte.
„Das Arbeitslosengeld ermöglicht es den Erwerbsarbeitslosen, weiterhin zu konsumieren“, lernten Generationen von Wirtschaftsstudierenden aus dem legendären Lehrbuch der Wirtschaftswundertage von Rüdiger Dornbusch und Stanley Fischer. Eine Weltwirtschaftskrise wie in den dreißiger Jahren könne daher nicht mehr geschehen, erklärten die Starökonomen. „Stabilisatoren … schützen die Volkswirtschaft.“
Damit steigen, wie etwa nach der Finanzkrise, automatisch die Defizite. Aber das waren, wie Stephanie Kelton, die Wortführerin der „Modern Monetary Theory“ schreibt, „Defizite, die die Welt retteten“.
Diese automatischen Stabilisatoren wirken aber nicht nur in der schweren Krise, sie wirken praktisch immer. Dass die krassen Ausschläge der Konjunkturzyklen, wie sie in den frühen Jahren des Kapitalismus gang und gäbe waren, heute eher moderater ausfallen, hat eben auch mit den automatischen Stabilisatoren zu tun, zu denen neben der Sozialpolitik ja auch die Finanzgebarung der Staaten und etwa die progressive Einkommensteuer zählen. Früher schossen im Boom die Konsum- und Investitionsausgaben in die Höhe, im Abschwung fielen sie schnell in den Keller. Das Steuer- und Sozialsystem führt heute aber dazu, dass die Ausschläge einfach sanfter ausfallen – sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
Diese „automatischen Stabilisatoren“ haben freilich den Effekt, dass in der Krise die Haushaltsdefizite der Staaten automatisch ansteigen. Die Steuereinnahmen sinken automatisch, die Einnahmen der Sozialversicherung auch, die Ausgaben steigen hingegen an. Konservative Ökonom*innen und Lobbygruppen nützen daher jede Krise für ihre Angriffe auf den Sozialstaat – die Defizite würden „explodieren“, Regierungen würden ihre Haushalte „nicht in den Griff bekommen“, ist dann das übliche Argument.
Absurditäten
Genau mit dieser krausen Idee wurde nach der Finanzkrise die harte Spar- und Austeritätspolitik in der Europäischen Union durchgesetzt. Man erinnere sich nur an die obskure Theorie, die der ultradoktrinäre italienische Ökonom Alberto Alesina aufstellte und der der damalige deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (und mit ihm die gesamte Eurozone) folgte: die Voraussage einer „Expansionary Fiscal Contraction“. Allein der Begriff („Schrumpfwachstum“) ist so absurd, dass eigentlich alle hätten laut loslachen müssen. Wenn Staaten ihre Ausgaben einschränken, würde das nicht zu einer Rezession führen, sondern zu einem Boom, war die These. Wie kam man zu dieser absurden Annahme? Wenn Staaten solide wirtschaften würden, dann würden die Unternehmen Vertrauen fassen, sie würden investieren und damit würde das Wachstum steigen.
„Confidence fairy“, das „Vertrauens-Märchen“, hat das Nobelpreisträger Paul Krugman damals genannt.