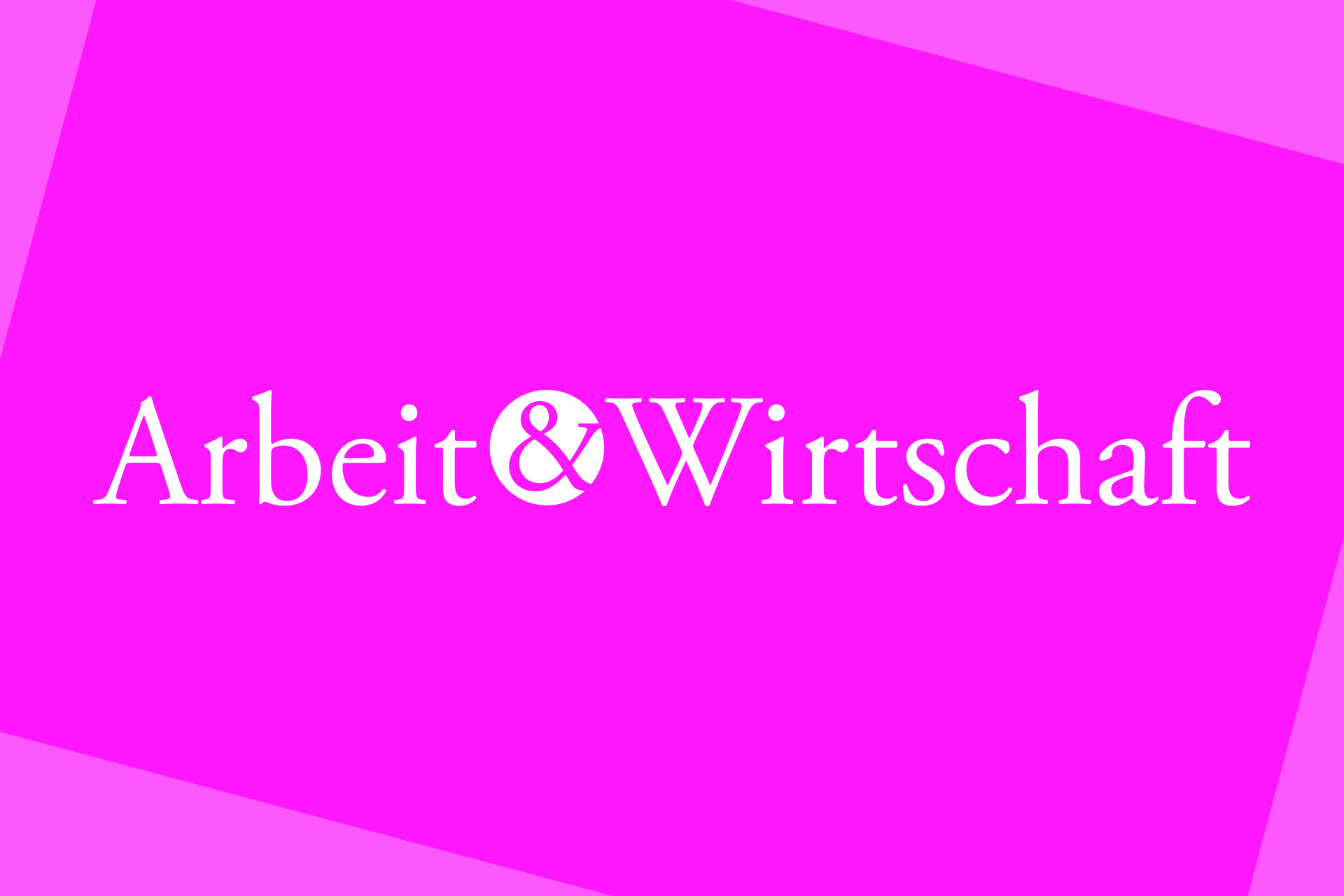Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
s ist geradezu ein Stehsatz, und doch ist er immer noch gültig: Gemeinsam ist man stärker. Wirft man einen Blick auf Kollektivverträge im europäischen Vergleich, so wird das am deutlichsten. Denn es ist zwar auch am österreichischen Arbeitsmarkt bei Weitem nicht alles gut. Doch dass 98 Prozent der Beschäftigten von einem KV erfasst sind, ist europaweit fast einzigartig. Jahr für Jahr leisten GewerkschafterInnen hier enorme Arbeit, die auch international anerkannt wird. So betonte die Europäische Kommission kürzlich die Vorteile des KV-Systems, ähnlich sieht es die OECD.
Dennoch versuchen Unternehmen, eben dieses System zu durchlöchern. Sie ordnen Beschäftigte falschen Kollektivverträgen zu und bringen sie damit um bares Geld. Sie lagern Arbeitsbereiche aus, um Kosten zu sparen und diese auf jene Menschen zu überwälzen, die für sie gute Arbeit leisten. Oder sie greifen zu allerhand anderen Tricks zum Nachteil der ArbeitnehmerInnen. Umso wichtiger ist die Arbeit von BetriebsrätInnen über Gewerkschaften bis zur AK. Im Zuge der Kollektivvertragsverhandlungen bringen GewerkschafterInnen zudem innovative Ideen ein, wie etwa die Freizeitoption, bei der Beschäftigte in bestimmten Branchen die Lohnerhöhung auch in Form von mehr Freizeit in Anspruch nehmen können. Oder auch die Anrechnung von Karenzzeiten, sodass Frauen nicht ständig das Nachsehen haben, weil es mit der partnerschaftlichen Aufteilung der Erziehungsarbeit leider weiterhin nicht weit her ist.
Mehr Freizeit ist denn auch das große Thema in der Sozialwirtschaft, wo man mit der Forderung nach einer 35-Stunden-Woche in die Verhandlungen gegangen ist. Angesichts der massiven Verdichtung der Arbeit, die in allen Branchen in jüngster Zeit stattgefunden hat, ist dies eine mehr als legitime Forderung. Von daher: Glück auf, liebe VerhandlerInnen!
Ich muss mich an dieser Stelle verabschieden. Nach fast sechs Jahren breche ich zu neuen Ufern auf. Meinen KollegInnen, aber natürlich insbesondere Ihnen wünsche ich weiterhin viel Freude an dieser wunderbaren Zeitschrift!
Autor:in – Sonja Fercher
![]() Sonja Fercher ist freie Journalistin und Moderatorin. Für ihre Coverstory im A&W Printmagazin zum Thema Start-ups erhielt sie im Juni 2018 den Journalistenpreis von Techno-Z. Sie hat in zahlreichen Medien publiziert, unter anderem in Die Zeit, Die Presse und Der Standard. Von 2002 bis 2008 war sie Politik-Redakteurin bei derStandard.at. Für ihren Blog über die französische Präsidentschaftswahl wurde sie im Jahr 2008 mit dem CNN Journalist Award - Europe ausgezeichnet.
Sonja Fercher ist freie Journalistin und Moderatorin. Für ihre Coverstory im A&W Printmagazin zum Thema Start-ups erhielt sie im Juni 2018 den Journalistenpreis von Techno-Z. Sie hat in zahlreichen Medien publiziert, unter anderem in Die Zeit, Die Presse und Der Standard. Von 2002 bis 2008 war sie Politik-Redakteurin bei derStandard.at. Für ihren Blog über die französische Präsidentschaftswahl wurde sie im Jahr 2008 mit dem CNN Journalist Award - Europe ausgezeichnet.
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
s ist schon eine ganze Weile her, doch mir wollte jahrelang nicht aus dem Kopf gehen, was uns eine Kärntner Verwandte zu Beginn der 2000er-Jahre erzählt hatte: Bis dahin konnte ihre Enkelin mit dem öffentlichen Postbus bequem und günstig zu ihrer Lehrstelle gelangen. Mit der Privatisierung dieser Strecke wurde das nun unleistbar für sie. Ähnlich erging es damals vielen Menschen in den ländlichen Regionen – und vielen blieb damit nur eine Alternative: der Umstieg auf den Pkw.
Schon damals ärgerte mich das. Denn dem Dogma, der Staat müsse sparen und könne sich keine defizitären Betriebe leisten, wurde alles untergeordnet. Dass solche Betriebe die günstige Mobilität vieler Menschen in den ländlichen Regionen ermöglichten: Dieses Argument wurde als realitätsfremd vom Tisch gewischt. Gleiches galt für die Mahnung, dass öffentlicher Verkehr einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Ein gutes Leben für alle
Dass Infrastruktur kostet, liegt auf der Hand. Dass sie aber auch ein Wert des Staates ist – ein konkreter Vermögenswert –, wird leider meistens übersehen. Dass sie vielen Menschen etwas bringt, ja, dass öffentliche Infrastruktur sogar ein zentrales Instrument sein kann, um die Gesellschaft gerechter zu machen – das sollte man keinesfalls vergessen.
Dass Infrastruktur kostet, liegt auf der Hand. Dass sie aber auch ein Wert des Staates ist – ein konkreter Vermögenswert –, wird leider meistens übersehen.
Der Gewinn besteht hier weniger in einer schwarzen Zahl, sondern vielmehr in einer guten Versorgung und besseren Chancen für die Menschen. Gewerkschaften und Arbeiterkammer sind bei diesen Themen ein beständiger Stachel im Fleisch. Sie drängen auf Regulierungen von privaten Anbietern und faire Förderungen im Sinne der ArbeitnehmerInnen. Sie fordern neue Infrastrukturmaßnahmen ein, wo sich der Bedarf abzeichnet – ob in der Pflege, bei der Digitalisierung oder beim Kampf gegen den Klimawandel. Das ist gut so, denn nicht Gewinne Einzelner sind das Ziel, sondern ein gutes Leben aller.
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
ehr Demokratie wagen, die Gesellschaft mit Demokratie durchfluten: Dies war in den 1960er/1970er-Jahren der Leitspruch von SozialdemokratInnen in ganz Europa. Mitbestimmungsrechte wurden auch in Österreich ausgeweitet, von der Schule über den Arbeitsplatz bis hin zur direkten Demokratie.
Demokratie ist fast zur Selbstverständlichkeit geworden, etwas, das man so nebenbei eben mitnimmt.
Demokratie ist fast zur Selbstverständlichkeit geworden, etwas, das man so nebenbei eben mitnimmt. Ein bisschen wie der Kaffeebecher oder das Menü to go. Es ist praktisch, es ist da, wenn man es braucht. Man kann es nutzen, muss aber auch nicht, wenn man nicht möchte. Ein bisschen wie das Pausenbrot, das einst oftmals in Alufolie gewickelt wurde. Es ist einfach da, man greift gerne dazu. Doch was dahintersteckt, wer es gemacht hat und welche Bedeutung es hat: Das ist nicht nur in Vergessenheit geraten, sondern wird für allzu selbstverständlich genommen. Ja, oft genug wird es gar als etwas Lästiges wahrgenommen, wie die Schwierigkeiten belegen, die ArbeitnehmerInnen in verschiedenen Betrieben bekommen, wenn sie einen Betriebsrat gründen möchten, wie zuletzt bei der Drogeriemarktkette Douglas.
Für Demokratie braucht es auch einen öffentlichen Diskurs, in dem Entscheidungen nicht nur im Vorfeld debattiert werden, sondern in dem auch Raum für Kritik und Kontrolle ist.
Doch was steckt denn nun in dieser Alufolie? Es mag pathetisch klingen, und doch ist es so: Demokratie ist eine der größten Errungenschaften der BürgerInnen- und ArbeiterInnenbewegung. Die Älteren unter uns haben noch Großeltern oder gar Eltern, die in einer Zeit aufwuchsen, in der sie gar kein Wahlrecht hatten. Vor Beschluss des allgemeinen Wahlrechts im Jahr 1918 in Österreich musste man Geld haben, um wählen zu können, Zensus nannte sich das. Erst mit Ausrufung der Republik hatten alle Staatsbürger und auch Staatsbürgerinnen das Recht, darüber mitzubestimmen, von wem sie regiert werden wollen. Dazu gehört nicht nur, dass sie über Prioritäten der Politik mitentscheiden können, sondern auch darüber, was mit den Steuern geschehen soll, die sie Monat für Monat an die Allgemeinheit abgeben. Dazu braucht es auch einen öffentlichen Diskurs, in dem Entscheidungen nicht nur im Vorfeld debattiert werden, sondern in dem auch Raum für Kritik und Kontrolle ist.
Mitbestimmung neu denken
Mit Demokratie durchfluten: Unter diesem Stichwort wurden auch Mitbestimmungsrechte in den Betrieben ausgeweitet. Zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten besteht immer ein Machtgefälle. Um dies auszugleichen, wurde schon Anfang des 20. Jahrhunderts die Mitbestimmung im Betrieb entwickelt. So sollten ArbeitnehmerInnen bzw. deren VertreterInnen im Betriebsrat die Möglichkeit bekommen, Dinge in ihrem Sinne zu verändern. Zugleich eröffnet sie auch für die Arbeitgeber die Möglichkeit, sinnvolle Vorschläge der ArbeitnehmerInnen zu bekommen. Denn da sie es sind, die die Arbeit erledigen, wissen sie auch am besten, wenn etwas unrund läuft, und haben Ideen, wie sich dies verbessern ließe. Diese Mitbestimmungsrechte wurden seit Mitte der 1970er-Jahre ausgeweitet.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Wirtschaftswelt enorm verändert, von Auslagerungen ganzer Standorte oder auch nur bestimmter Arbeitsplätze bis hin zu den neuen Herausforderungen der Digitalisierung, um nur einige zu nennen. Dies macht einerseits die Arbeit von BetriebsrätInnen herausfordernder, andererseits aber auch die gewerkschaftliche Organisation insgesamt. Es stellt sich somit die Frage, ob Mitbestimmung nicht neu gedacht werden muss.
Es stellt sich die Frage, ob Mitbestimmung nicht neu gedacht werden muss.
Aber auch bei den bestehenden Rechten gibt es Luft nach oben, wie Befragungen von BetriebsrätInnen immer wieder zeigen. Denn in bestimmten Bereichen schätzen sie ihre Mitbestimmungsmöglichkeiten als sehr gut ein, in anderen aber lassen sich die Arbeitgeber nur ungern in die Karten schauen. Zu Letzteren zählen ausgerechnet so wichtige Themen wie Personalfragen oder das Entgelt.
Demokratie mag mit Arbeit verbunden sein. Sie hat aber das Potenzial, dass die StaatsbürgerInnen darüber mitbestimmen können, wie man Dinge besser machen kann – und zwar im Sinne von möglichst vielen Menschen und nicht nur einer kleinen Gruppe.
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
s ist zwar bald 20 Jahre her, und doch werde ich diese Bilder nie vergessen: Bis auf die Straße standen die Leute, die Wohnung war oftmals im 4., 5. oder gar 6. Stock. Immer wieder blieb mir die Luft weg, wenn ich endlich in der Wohnung stand. Denn so manche Unterkunft hatte die Bezeichnung Wohnung kaum verdient. Üblich waren Gangklos, die nur aus Löchern im Boden bestanden. In einem hatte ein Bastler gar eine Klobrille an der Wand montiert. All das geschah im Februar 2001 in Paris, wo ich ein Auslandssemester absolvierte.
Verzweifelte Kreativität
Ein Mangel an Kreativität herrschte jedenfalls nicht, um möglichst viel aus den wenigen Quadratmetern zu machen. Immer in Erinnerung wird mir jene Dusche am Gang bleiben, in der auch gleich ein Geschirr- und Besteckkorb eingebaut war, den man per Seilzug bedienen konnte. Dabei musste man froh sein, dass die Dusche nicht im öffentlichen Schwimmbad nebenan stand.
Ein Mangel an Kreativität herrschte jedenfalls nicht, um möglichst viel aus den wenigen Quadratmetern zu machen.
Die Mieten waren gesalzen, der Andrang groß, entsprechend viele Unterlagen musste man vorlegen, um überhaupt erst in Betracht gezogen zu werden. Wer wie ich Studentin war, noch dazu aus dem Ausland, musste die Gehaltszettel der Eltern vorlegen. Und doch waren wir zweifellos privilegiert im Vergleich zu den vielen anderen Wohnungssuchenden. Die verschärfte Bedingung: Die Metro streikte, weshalb ich zu Fuß durch die Stadt hirschte und immer verzweifelter wurde – bis ich dann endlich ein WG-Zimmer fand, so teuer auch dieses dann letztlich war. Wie oft dachte ich mir: Wie gut es uns doch in Wien geht!
Wenn ich heute die Meldungen und bisweilen Horrorberichte vom Wiener Wohnungsmarkt lese, bin ich immer wieder fassungslos. Nie hatte ich es für möglich gehalten, dass Entwicklungen wie diese auch hier Einzug halten könnten. Denn anders als in Paris hielt man in Wien die Tradition des sozialen Wohnbaus hoch. Übrigens machte man in Paris damals schon Leerstände und Immo-Spekulationen für diese Missstände mitverantwortlich. Die Themen waren also bekannt, also hoffte ich, dass man in Wien alles daransetzen würde, um zu verhindern, dass es jemals so weit kommt. Leider sollte ich unrecht behalten.
Die Waschsalons sind zurück, freute sich vor einigen Jahren ein Freund von mir. Erneut stieg in mir eine Erinnerung aus Paris auf, wo es diese an fast allen Ecken gibt. Wenn man zu Hause eine Waschmaschine stehen hat, mag man die Vorstellung reizvoll finden, auch mal in einen Waschsalon zu gehen. Dort, wo eine Waschmaschine bei aller Kreativität keinen Platz mehr in der Wohnung findet, bleibt einem aber gar nichts anderes übrig – und angenehm ist das keinesfalls. Egal, wo ich beim Thema Wohnen hinschaue: Retro ist hier ganz und gar nicht schick. So waren in den historischen Wiener Gemeindebauten Einrichtungen wie die Waschküchen ein enormer Fortschritt für die Menschen. Wenn Wohnungen nun wieder so klein werden, dass darin eine Waschmaschine keinen Platz hat, oder wenn sich Menschen keine Waschmaschine leisten können, so ist dies nichts anderes als ein Rückfall in alte, viel schlechtere Zeiten.
Außer Rand und Band
Keine Frage, man hat in Wien erkannt, dass etwas geschehen muss – spät, aber doch. Das Problem aber ist, dass der Markt inzwischen außer Rand und Band ist, und das keineswegs nur in Wien. Dazu kommt, dass es auf Bundesebene sichtlich nur wenig politischen Willen gibt, daraus Konsequenzen zu ziehen – und zwar keineswegs nur bei Türkis und Blau, die eine klare Politik zugunsten der Immo-Wirtschaft gemacht haben.
Der Wohnungsmarkt ist kein Markt wie jeder andere. Besser gesagt: Er darf es deshalb nicht sein, weil Wohnen ein Grundbedürfnis von Menschen ist.
Was vor allem fehlt, ist die Einsicht: Der Wohnungsmarkt ist kein Markt wie jeder andere. Besser gesagt: Er darf es deshalb nicht sein, weil Wohnen ein Grundbedürfnis von Menschen ist. Genau deshalb müsste folgendes Thema auf der politischen Tagesordnung ganz oben stehen: Wie kann der Wohnungsmarkt so reguliert werden, dass möglichst viele Menschen in gutem Wohnraum zu leistbaren Preisen leben können?
Über Statussymbole drücken Menschen wohl am deutlichsten aus, wie gut es ihnen geht. Doch wie wichtig ist für die Menschen jener Besitz,den die Werbung so gerne verkaufen möchte? Welche Rolle spielt das Einkommen, die Arbeit selbst – und was macht sonst das gute Leben aus?
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
chneller, höher, stärker: Kaum ein Produkt verkörpert dieses Prinzip momentan besser als das Auto. Heutzutage wirkt der alte 911er-Porsche wie ein Matchboxauto im Vergleich zu den immer riesiger werdenden SUVs. Dieser scheint zum neuen Kleinwagen zu werden, auf den man früher jahrelang gespart hat. Groß und stark muss es heute sein. Entsprechend müssen auch jene Kraftfahrzeuge größer werden, mit denen man zeigt, dass man „wer ist“ – und in der Formulierung „wer sein“ steckt drinnen, dass es einem gut geht.
Es muss immer mehr, immer schneller, aber auch immer besser gearbeitet werden.
Schneller, höher, stärker: Nicht nur beim Konsum scheint dieses Motto, das eigentlich von den Olympischen Spielen stammt, momentan den Ton anzugeben. Auch die Arbeitswelt beschreibt es leider sehr gut: Es muss immer mehr, immer schneller, aber auch immer besser gearbeitet werden.
Dass die Werbung so agiert, ist völlig logisch, denn um eine Nachfrage zu generieren, müssen zunächst Mängel ausgemacht werden, die man mit entsprechenden Angeboten füllen kann – auf dass die Umsätze passen. Damit sie steigen, muss die Angebotspalette freilich ständig ausgebaut werden.
Werbung versucht kollektive Ziele zu formulieren: Nur wer diese oder jene Produkte besitzt, führt ein gutes Leben.
Kurzum, Werbung versucht kollektive Ziele zu formulieren: Nur wer diese oder jene Produkte besitzt, führt ein gutes Leben. Nur ein gutes? Nein, der Anspruch geht weit darüber hinaus: Es geht um das eine, richtige Leben. Dieser in der Werbung völlig logische Grundsatz ist mittlerweile auch in die politische Debatte übergeschwappt. So wird auch verständlich, weshalb etwa über Klimaschutz so emotional diskutiert wird.
Allerdings liegt dem ein sehr eindimensionales Menschenbild zugrunde. Denn was Menschen unter „einem guten Leben“ verstehen, das ist sehr individuell. Die einen leben gerne in der Stadt, die anderen gerne am Land. Für manche bedeutet ein gutes Leben, dass sie nach Jahren der Obdachlosigkeit wieder in die eigenen vier Wände einziehen können. Oder aber es ist der Job, den sie nach Jahren der verzweifelten Suche endlich antreten können. Für manche Beschäftigten ist das Plus am Konto wichtig, um sich bestimmte Dinge leisten zu können, für andere ist es das Mehr an Freizeit – und oftmals ändern sich die Ansprüche je nach Lebensphase.
Rahmenbedingungen schaffen
Aufgabe von Politik ist es nicht, eine Bewertung vorzunehmen und nur jenes Modell zu fördern, das sie jeweils für „das beste“ hält. Es geht darum, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen ein gutes Leben führen können – was auch immer sie selbst darunter konkret verstehen. Ihre Prioritäten sind klar, an vorderster Stelle rangiert die Gesundheit. Dieses Thema ist zugleich ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, was Gewerkschaften unter einem guten Leben für alle verstehen: Gesundheit soll eben nicht nur ein Privileg der wenigen Wohlhabenden sein, sondern alle sollen im Fall von Krankheit in den Genuss einer guten Behandlung kommen. Damit Menschen gar nicht erst krank werden, kann Politik an vielen Schrauben drehen: Sie kann Rahmenbedingungen für gute Arbeit schaffen, damit diese nicht krank macht. Sie kann den Wohnungsmarkt regulieren, damit gutes Wohnen kein Privileg der wenigen ist. Ein gutes öffentliches Bildungssystem wiederum sollte gute Chancen für alle Kinder gewährleisten.
Es geht darum, die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit Menschen ein gutes Leben führen können.
All das braucht eine solide Finanzierung. Dafür wiederum ist eine Änderung des Steuersystems nötig, denn Vermögende leisten momentan nur einen marginalen Beitrag, während Arbeit massiv belastet wird. Dazu gehört auch, dass wir über eine faire Verteilung der Wohlstandsgewinne diskutieren, sprich faire Löhne. Letztlich geht es auch darum, das vorherrschende Verständnis von Wohlstand infrage zu stellen.
Dazu braucht es einen Gestaltungswillen – und es geht darum, sich dabei nicht nur stur nach den Anforderungen und Wünschen von Unternehmen zu richten, sondern auch die Wünsche und Bedürfnisse der Beschäftigten zu berücksichtigen. Denn es geht eben nicht nur darum, ein gutes Leben von wenigen zu ermöglichen, sondern eines für alle!
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
s ist nicht die erste Meldung, die mich – gelinde gesagt – gewundert hat. Die Bildungsministerin der Übergangsregierung, Iris Rauskala, erklärte zum Thema Schulstreik für den Klimaschutz: Die Kinder mögen bitte in die Schule gehen, denn der Bildungsauftrag Klimaschutz könne auch in der Schulzeit erbracht werden.
Die Aussagen von Rauskala zum Thema Schulstreik für den Klimaschutz sind geradezu symptomatisch dafür, wie oberflächlich die Diskussionen über Klimapolitik geführt werden.
Die Aussagen von Rauskala sind geradezu symptomatisch dafür, wie oberflächlich die Diskussionen über Klimapolitik geführt werden: Man beschäftigt sich nicht mit dem Hauptschauplatz, sondern mit Nebensächlichkeiten, diese aber werden dafür umso emotionaler diskutiert. So als würde man bei einer Statue, deren Hand in eine Richtung weist, nur den Zeigefinger betrachten, statt den Blick dorthin zu richten, wohin dieser zeigt.
Worauf zeigt denn nun dieser Zeigefinger, den die Jugend so vehement erhebt? Er will aufzeigen, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Das Problem: Obwohl wir das alle längst wissen, machen wir so weiter wie bisher. Die angeblich so weise unsichtbare Hand des Marktes wird es schon richten, behaupten wirtschaftsliberale PolitikerInnen unverdrossen. Fakt aber ist, dass genau dieser Markt uns in diese Lage gebracht hat. Profit gegen billige Preise und versteckte Ausbeutung: So lautet die Formel, mit der sich das momentane System am besten zusammenfassen lässt. Zu diesem System gehört auch die Masse oder Monokultur. Bestes Beispiel dafür ist die Nahrungsmittelindustrie in Österreich. Ob bei Rinder- oder Schweinefleisch: Es wird mehr produziert, als verbraucht wird. Das Bild, wonach in Österreich die LandwirtInnen alle in kleinen Betrieben in schwierigem Gelände wirtschaften würden, ist nicht mehr als das: ein geschöntes Werbesujet für die Tourismusindustrie. Diese Betriebe gibt es freilich auch, doch sie konkurrieren bei den KonsumentInnen mit den großen Landwirtschaftsbetrieben – und können entsprechend nur schwer mithalten.
Profit gegen billige Preise und versteckte Ausbeutung: So lautet die Formel, mit der sich das momentane System am besten zusammenfassen lässt.
Gestaltungswille
Das Beispiel Landwirtschaft ist sogar noch in einer anderen Hinsicht aufschlussreich. Denn von der oft bemühten Marktwirtschaft kann hier nicht die Rede sein. Vielmehr steckt der Staat viel Geld in diesen Sektor. Dagegen ist ja auch grundsätzlich nichts einzuwenden, denn regional produzierte Waren sind eben auch klimafreundlicher. Es braucht also politischen Gestaltungswillen, hier erneut regulierend einzugreifen.
Es braucht politischen Gestaltungswillen, um regulierend einzugreifen. Nur passt ebendieser nicht zur Logik des Neoliberalismus.
Nur passt ebendieser politische Gestaltungswille nicht zur Logik des Neoliberalismus. Dieser setzt auf Privatisierung und Profite. Bestes Beispiel dafür ist die Bahn: Sie ist nicht rentabel, also muss gespart oder privatisiert werden – und so geschah es denn auch. Die Folge: Auf kleineren Linien gibt es entweder gar keinen Busverkehr mehr, weshalb die Menschen aufs Auto umsteigen mussten; oder aber private Anbieter übernahmen die Strecken, nur dass die Tickets so teuer sind, dass sie für die tägliche Mobilität nicht mehr infrage kommen. Nun sind die ÖBB gar nicht schlecht aufgestellt, sodass Bahnfahren in Österreich für viele Strecken in der Tat eine Alternative ist. Und man ist durchaus einfallsreich: Mit „Rail and Drive“ kann man immerhin auch in nicht von Bahn oder Bus erschlossene Gebiete kommen.
Die große Frage muss lauten: Warum muss die Bahn eigentlich rentabel sein? Ist es nicht vielmehr eine sinnvolle öffentliche Infrastruktur, und zwar in sozialer wie in klimapolitischer Hinsicht? Denn wer Öffis nutzen kann, muss nicht so viel Geld in die Mobilität stecken, sondern kann auch mal für Biolebensmittel mehr ausgeben. Diese wiederum schmecken nicht nur besser und sind gesünder – wenn sie nicht in der Masse produziert werden, sind sie auch deutlich klimafreundlicher. Was also fehlt, ist der politische Wille, öffentlichen Verkehr massiv auszubauen.
Was fehlt, ist der politische Wille, öffentlichen Verkehr massiv auszubauen.
Zurück zu den „Fridays for Future“: Als würde es den jungen Menschen darum gehen, einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Denn was soll ihnen das bringen, wenn die Welt zerstört wird, in der sie das Erlernte anwenden könnten? Und wie sinnvoll ist dieser Bildungsauftrag, wenn die Verantwortlichen, die diesen definiert haben, nicht das Nötige tun, um die Erde zu schützen
Momentan wird die Verantwortung für den Klimaschutz ständig herumgereicht. Um dem Klimawandel nachhaltig vorzubeugen, braucht es eine andere Wirtschaftslogik. Und: Klimapolitik ist Verteilungspolitik. Denn gerade wer ein geringeres Einkommen hat, verhält sich wenig klimaschädlich. Dafür leidet diese Gruppe am stärksten unter den Folgen. Mutige Politik ist gefragt, um die Wende herbeizuführen.
Das heutige Wirtschaftssystem beruht auf Ausbeutung, die auch den Mittelschichten weltweit zu mehr Wohlstand verhilft.
Umso wichtiger sind internationale Solidarität und die internationale Arbeit der Gewerkschaften.
Auf Dauer muss sich aber das System ändern.
Sonja Fercher
Chefredakteurin
Arbeit&Wirtschaft
uropa kann doch nicht alle aufnehmen: Dieses Argument wird gerne als Begründung verwendet, warum man die Grenzen dichtmachen müsse. Das Ding ist: So einfach kann man es sich in Europa nicht machen. Denn es ist eine Tatsache, dass Europa dazu beiträgt, dass Menschen anderswo die Flucht ergreifen. Nicht wegen der tollen Sozialleistungen, wie es sie in Österreich (noch?) durchaus gibt, was auch gerne behauptet wird. Ein viel wichtigerer Aspekt aber ist, dass auch wir in Österreich von einem Wohlstandsmodell profitieren, das darauf basiert, dass Menschen an anderen Orten der Welt ausgebeutet werden und/oder ihnen die Lebensgrundlage entzogen wird.
Unsolidarisches System
Man darf sich keine Illusionen machen: Dass der Wohlstand insgesamt gewachsen ist, ist ein Ergebnis dieses wahrlich unsolidarischen Wirtschaftssystems. Ob es das alltägliche Smartphone ist, für das Rohstoffe unter elenden Bedingungen inklusive Kinderarbeit abgebaut werden. Ob es Obst oder Gemüse ist, das ArbeiterInnen – im Übrigen mitunter auch in Österreich – unter unwürdigen Bedingungen ernten. Ob es Kleidung ist, die Menschen in Asien in Sweatshops ebenfalls unter schrecklichen Bedingungen herstellen. Dass Menschen vor solchen Bedingungen flüchten, kann man ihnen kaum verdenken. Allerdings sei hier auch betont: Es ist keineswegs so, dass alle nach Europa kommen. Ganze 84 Prozent der Flüchtlinge leben nämlich in Staaten mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Deshalb ist auch das eine Frage der internationalen Solidarität, dass der reiche Kontinent Europa seinen – vergleichsweise kleinen – Teil der internationalen Migration schultert.
Es ist eine Frage der internationalen Solidarität, dass der reiche Kontinent Europa seinen – vergleichsweise kleinen – Teil der internationalen Migration schultert.
Ja, können wir uns das denn leisten, wir dann als Nächstes gefragt. Diese Frage darf man nicht nur mit dem Hinweis beantworten, dass es sich auch ärmere Regionen leisten müssen. Denn in der Tat haben wir auch in Europa ein Gerechtigkeits- bzw. besser gesagt: ein Verteilungsproblem. Denn wer bezahlt denn all die staatlichen Maßnahmen, die es zur Bewältigung von Migration wie Integration braucht? Nun, es sind in erster Linie die arbeitenden Menschen, denn von ihnen werden die staatlichen Budgets zu einem Großteil finanziert.
So ist der Steuerkuchen in Österreich sehr ungleich verteilt: Mehr als 80 Prozent kommen aus Arbeit und Konsum. Der Rest stammt aus Kapitaleinkünften, Gewinnen und Vermögen – und gerade hier herrscht auch in Österreich eine enorme Ungleichheit. Gleiches gilt, was die Aufnahme der MigrantInnen betrifft. Denn wer muss das denn bewältigen? Aufgrund des ungleichen Bildungssystems sind es dann oft SchülerInnen in Schulen, denen ohnehin an allen Ecken und Enden die Mittel fehlen, um die Kinder gut auf die Zukunft vorzubereiten. Am Arbeitsmarkt sind es jene ArbeitnehmerInnen, die ohnehin schon unter Konkurrenzdruck stehen und wenig verdienen. Das rechtfertigt keinesfalls fremdenfeindliche Antworten, denn erstens lenken diese nur vom eigentlichen Thema ab. Zweitens sind MigrantInnen die Letzten, die dafür verantwortlich sind, dass das System so ist, wie es ist. Vielmehr sind sie es, die Konsequenzen dieses unfairen Systems als Erste zu spüren bekommen haben.
Die gute alte Systemfrage
Internationale Solidarität bedeutet also weitaus mehr, als Hilfsprogramme aufzulegen oder verantwortlich einzukaufen. Es muss bedeuten, das System selbst infrage zu stellen. Aber kann ich das denn als Einzelperson? Nun ja, zweifellos ist die Macht, die Individuen haben, sehr beschränkt. Aber machtlos ist das Individuum keineswegs. Es kann sowohl verantwortlich einkaufen als auch in Betrieben für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen. Gewerkschaften spielen hier eine sehr wichtige Rolle, denn sie sind es, die die Verteilungsfrage sowohl im In- als auch im Ausland stellen können und müssen. Denn was ist ein gutes Leben für alle in Europa wert, wenn es auf einem schlechten Leben von anderen beruht, die das Pech hatten, woanders geboren worden zu sein – ganz abgesehen davon, dass sich viele von ihnen mit dem Wunsch nach einem besseren Leben auf den Weg nach Europa machen.