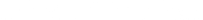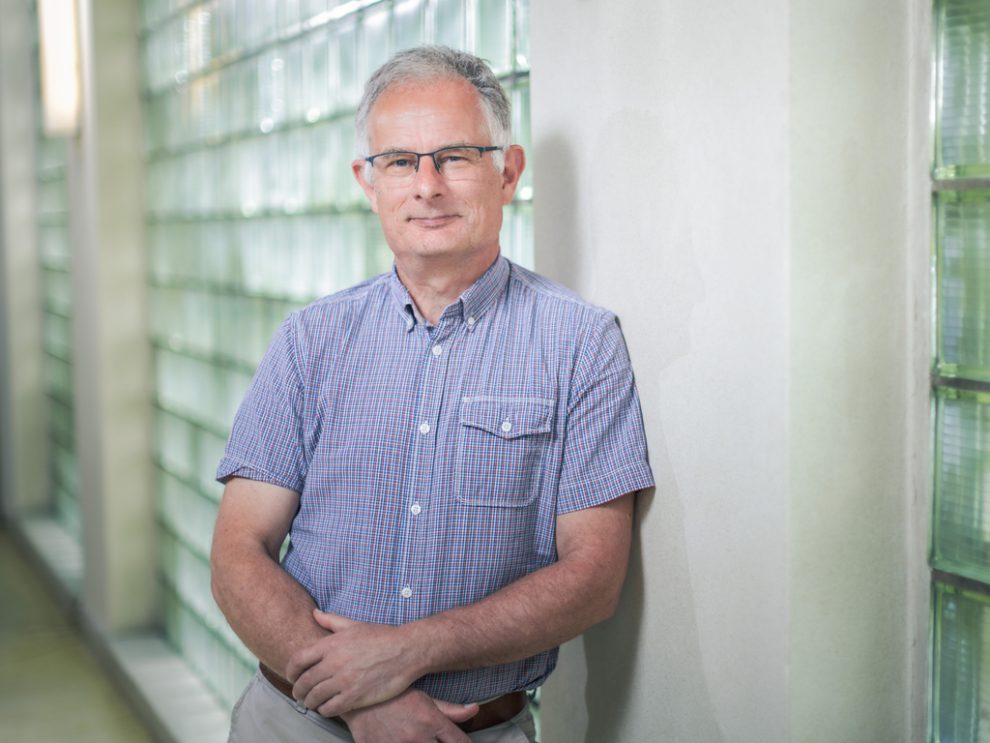Hoch sind nicht nur das Bildungs- und Einkommensniveau der Menschen, sondern auch das Niveau an Investitionen und Forschungsausgaben. Das Gesamtpaket der Rahmenbedingungen passe. Marterbauer sieht deshalb auch wenig Grund zum Jammern, sondern derzeit einen erfreulich positiven Trend. Die Industrieproduktion zieht an, die Stimmung für Investitionen steigt. Massiven Handlungsbedarf sieht der Ökonom vor allem darin, Hunderttausende Menschen, die keine, zu wenig oder schlechte Arbeit haben, in produktive Beschäftigung zu bringen. Klar ist aber auch: Die ökologische Transformation der Industrie, der Infrastruktur und des Mobilitätssystems muss vorangetrieben werden – und zwar rasch!
Arbeit&Wirtschaft: Die Arbeitslosigkeit in Österreich steigt, die Industrieproduktion ist in den vergangenen zwölf Monaten gesunken. Haben wir die Talsohle erreicht, oder ist die Wirtschaft im Jammertal gefangen?
Markus Marterbauer: Wir stehen an einer Trendwende. Zwar ist die Industrieproduktion im Laufe des Jahres 2023 merklich zurückgegangen, die Investitionsquote ist bei uns im Gegensatz zu Deutschland aber nach wie vor hoch, und die Produktion zeigt Anzeichen einer Erholung. Es gibt ein großes Potenzial an Arbeitskräften, das aktiviert, qualifiziert und genutzt werden muss.

Sind unsere Betriebe trotz vermeintlich hoher Lohnnebenkosten wettbewerbsfähig?
Wettbewerbsfähigkeit ist wichtig, und sie ist in Österreich auch recht gut. Der Export von Gütern und Dienstleistungen ist über die letzten Jahrzehnte deutlich rascher gestiegen als die Nachfrage aus dem Inland. Dazu tragen vor allem unsere stabilen Rahmenbedingungen bei – etwa die berechenbare Entwicklung der Löhne im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen. Sozialabgaben dürfen nicht als lästiger Kostenfaktor gesehen werden. Sie sichern den Standort ab, weil ein hohes Maß an sozialer Sicherheit den Unternehmen langfristige Verlässlichkeit garantiert. Investitionen in den Standort sind durch die stabilen und berechenbaren Rahmenbedingungen in Österreich sehr gut abgesichert. Firmen wissen das, und sie schätzen es als wertvollen Wettbewerbsvorteil. Gute Betriebe investieren daher trotz jüngst gestiegener Lohn- und Energiekosten, sie forschen und entwickeln innovative Technologien. Sie versuchen, gut qualifizierte Arbeitskräfte durch vorteilhafte Arbeitsbedingungen langfristig im Betrieb zu halten, und entwickeln neue Produkte.
Wie würden Sie den Wirtschaftsstandort weiter stärken?
Unser Standort ist stark, und das soll auch so bleiben. Wir wollen gute Rahmenbedingungen für gute Betriebe. Zentrale Herausforderungen dafür sind Bildung, Infrastruktur und eine ausreichende Zahl an Fachkräften. Derzeit haben viel zu viele Menschen keine oder schlechte Arbeit. Es
gibt beispielsweise rund 290.000 Arbeitnehmer:innen, die für einen Vollzeitjob weniger als 2.000 Euro brutto bekommen. Knapp 350.000 Menschen sind in der sogenannten „stillen Reserve“ des Arbeitsmarkts. Diese Menschen würden gerne arbeiten, können dies aber aus unterschiedlichen Gründen nicht. Außerdem gibt es Zehntausende Scheinselbstständige. Es wäre die Aufgabe des Arbeitsministers, diese Menschen in eine Arbeit zu bringen, von der man gut leben kann.

Haben wir zu wenige Fachkräfte?
In manchen Branchen und vielen Unternehmen ja. Doch es gibt große Potenziale an Leuten, die durch moderne und mutige Arbeitsmarktpolitik erschlossen werden könnten. Wir haben rund 280.000 Unterbeschäftigte, vor allem Teilzeitkräfte, die gerne mehr arbeiten würden, sofern die Rahmenbedingungen passen. 300.000 Ältere bilden eine teils hoch qualifizierte Reserve, die ungenutzt bleibt. Die Politik müsste die Arbeitsmarktpolitik breiter denken und diesen Menschen unkomplizierte Einstiege in den Arbeitsmarkt anbieten. Beim AMS scheinen sie gar nicht auf.
Vom Jammern über hohe
Kosten ist noch kein Betrieb reich geworden,
sondern immer nur durch Investitionen.
Markus Marterbauer,
AK-Chefökonom
Wie steht’s um unsere Wirtschaft im Vergleich zu Deutschland?
Österreichs Industrie gehört zu den stärksten in Europa. Sie erzeugt jährlich rund ein Fünftel der gesamten Wertschöpfung, des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die hergestellten Güter werden zu einem großen Teil exportiert, Dienstleistungen ebenso. Der Standort Österreich wird sehr geschätzt – Unternehmen investieren jährlich rund 70 Milliarden Euro mehr als in Deutschland. Wenn man die Entwicklung der Industrie über die letzten acht Jahre hinweg betrachtet, steht Österreich im Vergleich zu Deutschland, wo die Produktion um sieben Prozent geschrumpft ist, mit einem Wachstum von 25 Prozent ausgezeichnet da.

Im Laufe des Jahres 2023 ist die Produktion merklich zurückgegangen. Das ist die Folge von Kriegen, hohen Rohstoffpreisen und Unsicherheiten, die weltweit zur Verschiebung von geplanten Investitionen geführt haben. Das hat unsere Industrie erheblich getroffen, die technische Anlagen und Komponenten herstellt. Aktuell stehen wir an einem Wendepunkt der Konjunktur, der Standort Österreich wird international als langfristig stabil und sicher eingeschätzt.
Wie wichtig ist die Konsumnachfrage?
Die Kaufkraft ist ein wichtiger Standortfaktor, der die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe stützt. Insgesamt ist die Inlandsnachfrage nach Gütern und Dienstleistungen ebenso groß wie die Exportnachfrage. Das muss man im Auge behalten – die Konsumnachfrage wird durch stabile Arbeitseinkommen abgesichert. 2023 haben die Menschen durch massive Teuerungen an Kaufkraft verloren. Durch die Einmalzahlungen der Regierung und die durchwegs guten, von den Gewerkschaften ausgehandelten Lohnabschlüsse haben wir derzeit Reallohngewinne von drei bis vier Prozent – das wird die Nachfrage beflügeln.
Braucht es Steuersenkungen für Unternehmen, um Investitionen zu fördern?
Die Kürzung von sogenannten Lohnnebenkosten wäre ein geringer Anreiz für Investitionen. Große Firmen treiben die Transformation voran, sie siedeln sich an und investieren, wenn der Staat verlässliche Rahmenbedingungen schafft und bei der Bewältigung schwieriger Situationen unterstützt. In erfolgreichen Volkswirtschaften gibt es ein enges Zusammenspiel zwischen Staat und Gemeinschaft sowie den Unternehmen. Die Betriebe haben Anspruch auf eine stabile soziale Entwicklung, ein funktionierendes Ausbildungssystem, gute Infrastruktur und passende Verkehrswege sowie Energienetze. Dann wird kräftig investiert, und Unternehmen bekommen auch gute Arbeitskräfte.

Was gerne übersehen wird: Ein Großteil der arbeitsbezogenen Abgaben fließt in die Finanzierung des Sozialstaats. Bei wichtigen sozialen Ausgaben wie der Kranken-, Pensions– oder Arbeitslosenversicherung darf nicht gekürzt werden, sie sind die Basis für einen stabilen Wirtschaftsstandort. Mit Wirtschaftsvertreter:innen, denen die sonstigen Lohnnebenkosten zu hoch sind, würden wir gerne über alternative Finanzierungsmöglichkeiten reden, etwa über vermögensbezogene Steuern oder Gewinnsteuern. Vom Jammern über hohe Kosten ist noch kein Betrieb reich geworden, sondern immer nur durch Investitionen.
Sehen Sie auch die Betriebe in der Pflicht?
Unternehmen, die gute Arbeitsbedingungen bieten, haben bessere Chancen, gute Arbeitskräfte zu bekommen. Fachkräfte heuern lieber bei innovativen Betrieben an, die attraktive Arbeitszeiten und eine gute Bezahlung bieten. Derzeit kommen vier Arbeitslose auf eine offene Stelle. Dieses Verhältnis wird demografiebedingt sinken. Dann können sich die Menschen aussuchen, in welchem Betrieb sie arbeiten möchten, und die Betriebe müssen sich bemühen, Leute zu bekommen.
„Stillstand“, „Abstiegsgefahr“, im „Würgegriff“ der hiesigen Steuerpolitik: Wirtschaftsvertreter:innen fahren alle Geschütze auf, um den #Standort schlecht zu reden. Doch was dahinter steckt, ist reines Kalkül. 👇https://t.co/D0NcFPunmF
— Arbeit&Wirtschaft Magazin (@AundWMagazin) June 25, 2024
Welche Rolle spielt die Sozialpartnerschaft?
Sie ist ein wichtiger Faktor für den stabilen und sicheren Wirtschaftsstandort Österreich. Es ist bekannt, wie Lohnverhandlungen bei uns ablaufen. Unternehmen können sich auf langfristig stabile Lohnabschlüsse einstellen und kennen ihr Gegenüber in den Verhandlungen meist gut. Die gute Vertrauensbasis stabilisiert die Erwartungen und macht die Entwicklungen einschätzbar. Wir sehen, dass in der Industrie tolleLöhne bezahlt werden, so steigen metalltechnische Facharbeiter:innen mit einem Anfangsgehalt von rund 2.400 Euro ein. Die Arbeitszeiten haben sich bei 37 oder 38 Stunden eingependelt, im Schichtbetrieb gilt oft die 32-Stunden-Woche. Diese starken Sozialpartner-Lösungen erzeugen motivierte Beschäftigte und wettbewerbsfähige Betriebe – so soll es sein.
Welche Rolle spielt die Zuwanderung?
Österreich ist ein Einwanderungsland, und das ist ebenso wichtig für die Stabilität des Wirtschaftsstandorts und die Finanzierbarkeit des Sozialstaats wie eine gute Integration der Arbeitskräfte. Diese sollten sich nicht als Gastarbeiter:innen, sondern als vollwertige Mitglieder des Arbeitsmarkts fühlen können. Dazu muss sowohl im Schulsystem als auch in den betrieblichen Ausbildungssystemen Integration stärker in den Fokus rücken. Die Kinder der Migrant:innen von heute sind die Facharbeiter:innen von morgen. Wir müssen sie ausbilden und in die Betriebe integrieren, um ihre Aufstiegschancen zu verbessern.

Wo muss in Zukunft investiert werden?
Die Exportindustrie mit den großen Industriebetrieben wird weiterhin das wichtigste Standbein der heimischen Wirtschaft bleiben. Die ökologische Transformation der Industrie, des Mobilitäts- und Energiesystems und leistbarer Wohnraum sind die wichtigsten Fragen unserer Zeit. Eine rasche Umstellung auf Elektrolichtbögen bei den Hochöfen in der Stahlindustrie oder die Erhöhung des Recyclinganteils, etwa in der Aluminiumindustrie, bringen entscheidende Wettbewerbsvorteile.
Den umweltgerechten Ausbau der Transportinfrastruktur sowie der öffentlichen Nah- und Fernverkehrsnetze sehe ich als zentrale Zukunftsaufgabe des Staates. Mobilität auf Basis des Verbrennungsmotors hat ausgedient. Es braucht neue Infrastrukturen, etwa Ladestellen für Elektromobilität. Die öffentliche Hand muss als verlässlicher und langfristiger Partner und Investor auftreten, wenn es darum geht, Unternehmen zu animieren, ihre Produktionen klimaneutral umzubauen. Der soziale Wohnbau ist in den letzten Jahren zu wenig forciert worden. Aktuell haben wir einen Mangel an leistbarem Wohnraum – es wird Zeit, dass die gemeinnützigen Wohnbauträger wieder mehr investieren. In der Produktion einiger strategisch wichtiger Artikel wie Medikamente oder Solar-Paneele sollte sich die EU nicht mit Dumpingprodukten aus China überschwemmen lassen, sondern diese Produktionen durch gezielte Investitionen in Europa stärken.