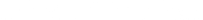Wie Krisen den Konsum beeinflussen
Es ist eine Vielzahl an Krisen, die seit Jahren an uns zerren. Nach der Corona-Krise kam die Teuerung, gefolgt vom Ukraine-Krieg. Durch Extremwetter hat auch die Klimakatastrophe einen immer größeren Einfluss auf unseren Alltag. Diese Krisen ändern (bewusst oder unbewusst) unser Konsumverhalten auf unterschiedliche Weise.

Auf der Hand liegt, dass wir anders einkaufen, wenn die Preise steigen. Die einfache Weisheit, dass Arbeit vor Armut schützt und einen gewissen Lebensstandard garantiert, gilt nicht mehr. Denn die Befragung hat gezeigt, dass sich die Arbeitssituation der Menschen zwar kaum verändert hat, das Einkommen aber nicht mehr reicht. Das liegt vor allem daran, dass selbst konstante oder sogar leicht gestiegene Löhne durch die Inflation teils massiv an Kaufkraft verloren haben.
Doch auch Corona und die Klimakatastrophe beeinflussen das Kaufverhalten. So hat die Pandemie beispielsweise zu einem höheren Gesundheitsbewusstsein geführt, das sich auch in der Ernährung widerspiegelt. Auch Bioprodukte und Lebensmittel aus der Region haben theoretisch an Bedeutung gewonnen, sind in Praxis aber häufig zu teuer. „Ich bin sehr viel bewusster beim Einkaufen. Regionalität war immer ein Kriterium, aber jetzt ist es Regionalität und Preisbewusstsein“, zitiert die Studie eine Befragung.
Nach Jahre der Krise: Die neue Wirklichkeit
Krisen haben Einfluss auf die Arbeit. Die grundsätzliche Situation hat sich für die Haushalte, die bei der Befragung mitgemacht haben, nicht geändert. Was sich allerdings geändert hat, ist die Art und Weise. Arbeit sei primär schwerer geworden – Druck und Leistungserwartung seien enorm gestiegen. Auch haben manche Unterstützung vermisst, als eine Umstellung auf das Homeoffice stattfand. Kinderbetreuung und Arbeit unter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig neue Programme für das mobile Arbeiten zu trainieren, hat viele Beschäftigte enorm belastet.
Weil parallel die Inflation das Einkommen geschmälert hat, kam es zu Veränderungen bei den Ausgaben. Ein echtes Ansparen für spätere Krisenzeiten sei für viele kaum noch möglich. Dazu kommt, dass die Menschen auf viele Produkte direkt verzichten oder die Ausgaben dafür enorm zurückfahren. Dazu gehören Energie, Kleidung, Gesundheitsprodukte und die Benutzung des eigenen Autos. Versicherungen würden kaum noch neue abgeschlossen. Gleichzeitig ändert sich die Art, wann und wie Geld ausgegeben wird. Produkte werden länger genutzt und häufiger repariert und größere Ausgaben (neues Auto, größere Haushaltgeräte) werden aufgeschoben oder komplett gestrichen. Auch Renovierungs- und Sanierungsarbeiten stehen jetzt unten in der Prioritätenliste.
Besonders deutlich wird diese Veränderung in der Freizeit. Viele Haushalte verzichten gänzlich darauf, in den Urlaub zu fahren. Andere machen lieber günstigeren Urlaub in Österreich als im Ausland. Außerdem schränken sich die Befragten bei ihren Freizeitaktivitäten stark ein.
Wie wir nach Jahren der Krise jetzt einkaufen
Eine Teilnehmerin der Studie erklärt, dass sie jetzt verstärkt Eigenmarken von Lebensmittelhändlern kaufen würde, weil diese günstiger seien. Damit spricht sie für viele der Befragten. „Die meisten Teilnehmer:innen geben an, bei ihrem Einkauf vermehrt Rabattaktionen und Rabattmarken zu nutzen. Manche planen ihren Einkauf so, dass sie möglichst viele Aktionen gleichzeitig ausnutzen können.“
Man kann sich fast nichts mehr extra leisten.
Man kann nur überlegen, die Wohnung zahlen, das
Essen und das Notwendigste.
Und ja, es bleibt einfach nichts übrig.
Teilnehmende Person der Studie „Konsum & Krise“,
Entsprechend seien Spontankäufe zurückgegangen. Die Menschen würden sich gezielter an Einkaufslisten orientieren. Und diese arbeiten sie zunehmend bei Discountern und Sozialmärkten ab.
Unzufrieden mit der Regierung
Die Studienteilnehmenden artikulierten auch eine nicht unerhebliche Unzufriedenheit mit der Regierung im Umgang mit den unterschiedlichen Krisen. Die größte Unzufriedenheit sei demnach bei der Teuerungskrise entstanden. Die Menschen gaben an, „keine oder zu geringe Hilfe zu erhalten und meinen einhellig, dass die Regierung zu wenig für sie tue.“ Einmalzahlungen seien in Anbetracht nachhaltig gestiegener Preise nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nur noch Unverständnis haben die Befragten für die Regierung in Bezug auf die Klimakrise. Sie verstehen nicht, warum wenig bis gar nichts dagegen getan werde.
Nicht ganz so schlecht kommt die Regierung bei der Bewertung der Corona-Pandemie weg. Dafür, dass es sich um eine nie dagewesene Situation gehandelt habe, hätten die Verantwortlichen gut reagiert. „Auch wenn einige Maßnahmen sehr stark in das Leben eingegriffen haben, ist man aber weitgehend zufrieden mit dem Umgang der Regierung während der Pandemie“, heißt es in der Studie.

Lösungen, um die Spirale der Krisen zu durchbrechen
Die Arbeiterkammer hat angesichts der nachhaltigen Probleme, die durch die Krisen entstanden sind, Lösungsansätze erarbeitet. Zu den dringlichsten gehört es, die Mietpreisbremse zu überarbeiten. Die AK fordert, die Mietsteigerungen auf 2 Prozent zu begrenzen – und das auch rückwirkend für die Jahre 2022 und 2023. Die Bremse von 5 Prozent für die Jahre 2024 bis 2026 sei angesichts der aktuellen Inflationsrate (im Mai 2024 waren es 3,3 Prozent) wirkungslos.
Zudem müsste eine Preistransparenzdatenbank eingeführt werden, mit der ungerechtfertigte Preiserhöhungen unterbunden werden könnten. Das kann auch mit der Abschaffung des „Österreich-Aufschlags“ gelingen. Der Preismonitor der AK zeige, dass große Konzerne für Markenprodukte hierzulande deutlich mehr Geld verlangen als in den Nachbarländern. Die AK hat deswegen sogar schon Kontakt mit der EU-Kommission aufgenommen.
Vor allem die Teuerungen hatten massive Auswirkungen auf die Wiener:innen, zeigt #AK Studie, #BOKU. „Die #Teuerung setzt den Menschen zu. Viele müssen nach wie vor ihr Einkommen genau planen und sparsam umgehen“, sagt AK Konsument:innenschützerin @GabrieleZgubic @krone_at 🔽 pic.twitter.com/J7hKrgk2E1
— AK Österreich (@Arbeiterkammer) June 19, 2024
Auch bei den Energiekosten böten sich Lösungen an. „Die Bundesregierung soll die Energiekonzerne gesetzlich verpflichten, eine leistbare Energieversorgung im Sinne der Daseinsvorsorge für alle sicherzustellen (gemeinwirtschaftliche Verpflichtung vor Gewinnorientierung) und einen vergünstigten Tarif bei Wärme und Strom für Konsument:innen mit geringem Einkommen anzubieten“, fordert die AK.
Weiterführende Artikel:
Teuerung: Inflationäre Fehlentscheidungen